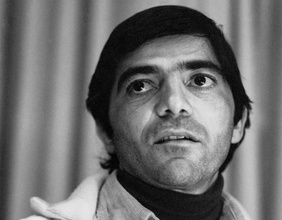Akademie für Alte Musik unter Attilio Cremonesi
Händels "Jephta" in Ö1
Händels Arbeit am Oratorium "Jephta" schritt aufgrund seines Augenleidens nur langsam voran. Es dauerte daher über acht Monate bis zur Vollendung des Werks im August 1751. In diesem Oratorium greift Händel die Geschichte des jüdischen Helden Jephta auf.
8. April 2017, 21:58
Als Händel gegen Ende Jänner 1751 mit der Arbeit an "Jephta" begann, war seine Gesundheit stark angegriffen. Vor allem mit seiner Sehkraft hatte er große Schwierigkeiten und notierte, nachdem er die ersten beiden Akte vertont hatte, vor dem Schluss des zweiten: "Biß hierher kommen, den 13. Februar 1751, verhindert worden wegen, des Gesichts meines linken Auges. Too relaxt" - so stark nachgelassen hatte also sein linkes Auge, dass er nicht weiterschreiben konnte.
Auch durch verschiedene Kuren sollte sein Augenleiden - es war der graue Star - nicht besser werden. Ja Händel war am linken Auge schließlich gänzlich blind geworden. Die Arbeit schritt daher nur langsam voran. Während er sonst etwa zehn Tage für einen Oratorien-Akt gebraucht hatte, dauerte es nun bis Ende August 1751 - also über acht Monate -, bis das Werk vollendet war.
Text von Thomas Morell
Händel vertonte in "Jephta" wiedereinmal einen Text von Thomas Morell, einem Dichter mit dem er ab der Mitte der 1740er Jahre zusammenarbeitete. Gemeinsame Projekte waren unter anderem die Oratorien "Theodora" und "Judas Maccabäus".
Morell greift in "Jephta" auf die Geschichte des jüdischen Helden Jephta, wie sie im 11. Kapitel des Buches der Richter im Alten Testament beschrieben wird, zurück: Jephta gelobt, daß er, wenn er die Ammoniter besiegt, das erste Lebewesen, das ihm bei seiner Rückkehr zu Hause begegnet, zum Brandopfer opfern werde. Als er schließlich siegreich zurückkehrt, ist das erste Lebewesen, das in zu Hause begrüßt, seine eigene Tochter Iphis. Dem Gelübte gemäß wird sie von Jephta geopfert". Soweit eine geraffte Schilderung der Geschichte, wie sie im Alten Testament beschrieben wird.
Kein blutiges Ende
Martin Luther kommentiert: "Man will, er habe sie - nämlich Iphis - nicht geopfert, aber der Text steht da klar".
Aber keine Angst, im Oratorium gibt es natürlich kein so blutiges Ende, sondern ganz im Gegenteil ein "lieto Fine".
Dem Zeitgeist entsprechend
Das Sujet zu "Jephta" paßte ja sehr gut in die Entstehungszeit dieses Oratoriums, denn biblische Kriegshelden waren im England des 18. Jahrhunderts besonders beliebt:
So boten sie geeignete Identifikationsgestalten für die kriegerischen Unternehmungen der Engländer selbst - gegen die Iren und, in den 1740er-Jahren vor allem gegen die für ihre Unabhängigkeit kämpfenden Schotten. Händel hat mit "Josua" und vor allem mit "Judas Maccabäus" dieser Zeitströmung gehuldigt.
Dreiaktige Version wie bei Oper
Im "Jephta" steht aber nicht mehr nur der Titelheld im Mittelpunkt, sondern auch die Gestalt der Tochter Iphis, der Mutter und des Verlobten Hamor werden zu Hauptgestalten des Werkes.
Übrigens kommen Personen wie die Mutter Storge, Zebul, der Bruder Jephtas, und Hamor, der Liebhaber der Iphis, in der Bibel gar nicht vor. Sie sind also eine recht opernhafte Zutat des Textdichters Thomas Morell. An die Oper erinnert auch die Einteilung des Werkes in drei Akte, vor allem aber der Schluß, der nicht so grausam ist, wie er in der Bibel beschrieben wird. In der Bibel wird ja Iphis von ihrem Vater Jephta wirklich geopfert. Im Glauben an das Gute im Menschen und an den Fortschritt in der Geschichte wollte man Mitte des 18. Jahrhunderts einfach kein tragisches Ende aktzeptieren.
Wiederverwendung von Kompositionen
Händel hatte zeitlebens die Gewohnheit, in seinen Werken eigene, aber auch fremde Kompositionen, meist in bearbeiteter Form wiederzuverwenden. Auch in seinem letzten Oratorium "Jephta", hat Händel auf ältere Vorlagen zurückgegriffen.
So stammen von den insgesamt 44 Nummern allein neun von fremden Vorlagen, für zehn griff er auf ältere eigene Werke zurück. Die Ouvertüre zum Beispiel übernahm Händel von seiner Bühnenmusik zu "Alceste".
Hör-Tipp
Georg Friedrich Händel, "Jephta", Oratorium, HWV 70, Donnerstag, 25. Mai 2006, 19:30 Uhr
Links
Akademie für Alte Musik Berlin
George Frideric Handel