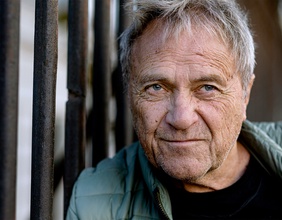Mit differenzierten Instrumentationseffekten
Haydns "Die Jahreszeiten"
In diesem Genre war ihm bereits ein höchst erfolgreiches Werk geglückt, die neue Komposition sollte eine würdige Nachfolgerin sein: Haydns Oratorium "Die Jahreszeiten". Der Andrang bei der Uraufführung 1801 war enorm, bald folgten Wiederholungen.
8. April 2017, 21:58
"Komm holder Lenz": Flanders Opera, Monteverdi Chor
Es ist ein Alterswerk eines Komposition, der auf die 70 zu ging und während des Schreibens Angst hatte, dass ihm die Kraft und die Ideen ausgehen könnten - was mitnichten der Fall war. Außerdem hatte er in diesem Genre bereits ein unglaublich erfolgreiches Beispiel gesetzt. Und das neue Werk sollte eine würdige Nachfolgerin sein:
Joseph Haydns Oratorium "Die Jahreszeiten". Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen diesmal Ausschnitte aus dem "Frühling" dieses Haydn-Werkes, dessen Uraufführung am 24. April 1801 im Palais Schwarzenberg in Wien stattfand.
Enorme Nachfrage
Der Publikumsandrang bei der Uraufführung war so gewaltig, dass es zu einer zweimaligen Wiederholung in den darauf folgenden Tagen kam.
Am 24. Mai folgte schließlich eine Privataufführung am kaiserlichen Hof, bei der die Kaiserin selbst eine der drei Gesangspartien übernahm. Der Komponist attestierte ihr zwar Geschmack und Ausdruck, bemängelte aber deren "schwaches Organ".
Differenzierte Klangeffekte
Die Liebhaber von Oratorien schätzen vor allem die unglaublich differenzierten Instrumentationseffekte und die tonmalerischen Darstellungen in Haydns "Jahreszeiten" - wie etwa die plastischen Beschreibungen des Zirpens einer Grille, des Vogelgezwitschers oder eines herrlichen Gewitters, das wie ein Vorgriff auf Beethovens Pastorale wirkt.
Mit großem Orchester
Bei diesem Werk setzt Haydn großes Orchester ein: Je zwei Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, die Trompeten und Posaunen besetzt er dreifach, die Hörner gar vierfach. Weiters wirken ein Kontrafagott, Pauken, Triangel, Tamburin, natürlich Streicher und Basso continuo mit.
Für die Einleitung zu seinen "Jahreszeiten" wählt Haydn ein aufgewühltes g-Moll. Es soll, wie er anmerkt, den Übergang vom Winter zum Frühling darstellen.
Drei Solostimmen als Kommentatoren
In Haydns "Jahreszeiten", deren Libretto Gottfried van Swieten nach James Thomsons Lehrgedicht "The Seasons" verfasste, kommen auch drei Solo-Stimmen vor. Die Namen dieser rechtschaffenen Landleute gehen mit Rollenbezeichnungen einher:
Der schwerfällige Pächter Simon, ein Bass, die artige Tochter Hanne (Sopran) und der verliebte junge Bauer Lucas (Tenor). Es sind Typen wie aus der Opera buffa und der Wiener Posse, die quasi auf dem Weg zu Lortzings heiteren Volksopern sind. Sie tragen Biedermeierkostüm, sind aber nicht Handelnde, sondern Betrachtende - wie der Musikologe Armin Raab treffend meint - Betrachtende - so wie die Zuhörer. Sie lenken abwechselnd als Kommentatoren den Blick auf die Erscheinungen der Natur.
Vergleich Flanders Opera Choir - Monteverdi Choir
Vor dem Choreinsatz herrscht bukolische Grundstimmung (G-Dur, 6/8-Takt). Es ist ein erstes Beispiel einer volkstümlichen Liedhaftigkeit, die Haydns beide große Oratorien so beliebt beim Publikum gemacht hat. Zwar setzt der Chor nicht mit einem Knalleffekt wie beim "Es werde Licht" in der "Schöpfung" ein, sondern eben dolce - langsam und allmählich ist der Winterschlaf vorbei. Das hört sich bei The Choir of the Flanders Opera unter Sigiswald Kujken fast etwas zu ernst, zu missmutig an.
Im Optimismus überzeugender, strahlender, lächelnder, den Frühling erwartend klingt diese Stelle mit dem Monteverdi Choir unter John Eliot Gardiner.
Hör-Tipp
Ausgewählt, Mittwoch, 26. April 2006, 10:05 Uhr
Links
AEIOU - Joseph Haydn
Gottfried van Swieten
Übersicht
- Interpretationen