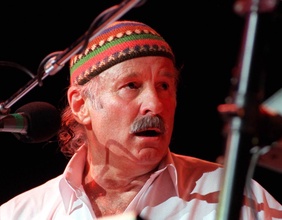Die Geschichte der Psychoanalyse
Freuds Jahrhundert
Auch in den Buchhandlungen findet der runde Freud-Geburtstag seinen Niederschlag. Aus der Fülle von Freud-Neuerscheinungen ragt eine Geschichte der Psychoanalyse heraus, die der in Brooklyn geborene Historiker Eli Zaretsky verfasst hat.
8. April 2017, 21:58
Die Geschichte der Psychoanalyse ist mythenumrankt wie die Biografie ihrer Gründungsväter, und es darf bezweifelt werden, dass die zahlreichen Neuerscheinungen rund um Sigmund Freuds 150. Geburtstag zur Entmythologisierung beitragen werden. Die Tatsache, dass Eli Zaretskys historische Auseinandersetzung mit "Freuds Jahrhundert" bereits 2004 unter dem glücklicher gewählten amerikanischen Originaltitel "The secrets of the soul: A cultural and social history of psychoanalysis" erschienen ist, hebt das Buch wohltuend vom inflationären Reigen der Anlasspublikationen ab.
Er wolle, so der Autor, die Psychoanalyse sowohl in ihrer repressiven als auch in ihrer emanzipatorischen Dimension darstellen und führt die Ursache dieser Janusköpfigkeit auf die Wesenhaftigkeit des Projekts zurück, die sich in Sigmund Freuds Selbstverständnis begründe.
Prozess der Selbstentdeckung
Seine zentrale Einsicht - die sich von romantischen und viktorianischen Vorstellungen vom Selbst grundlegend unterschied - bestand darin, dass das Innenleben des modernen Menschen durch persönlich eigensinnige Symbole und Erzählungen organisiert ist, die keine gesellschaftlich allgemein gültige Bedeutung haben. (...) Er hatte nicht vor, ein gestörtes Individuum wie der Schamane, der Heiler oder der Priester in eine vorgegebene Ordnung zurückzuführen, sondern er formulierte das analytische Projekt als eine persönliche und provisorische Hermeneutik der Selbstentdeckung, als einen Prozess, den der Psychoanalytiker in Gang bringen und erleichtern, aber nicht kontrollieren kann.
Was Sigmund Freud für die in diesem Sinne "unkontrollierbare Entwicklung" des Individuums beschrieb, das gilt im selben Maße wohl auch für die Entwicklung der psychoanalytischen Theorie und Praxis selbst. Zaretsky erfindet das Rad keineswegs neu, das große Verdienst seiner luziden Abhandlung besteht vielmehr darin, dass er weithin bekannte Tatsachen in einen zeitgeschichtlichen Zusammenhang stellt, die schlichtweg erhellend und obendrein spannend zu lesen sind.
Zeitreise durch das 20. Jahrhundert
Beginnend im politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Milieu im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts, in dem Sigmund Freud seine Thesen zum Unbewussten erstmals formulierte, begleitet Eli Zaretsky den Leser auf einer Zeitreise durch das 20. Jahrhundert und wird dabei nicht müde, das, was er den "Doppelcharakter" der Psychoanalyse nennt, in größtmöglicher Breite und mit größtmöglicher Tiefenschärfe auszuleuchten. Am deutlichsten wird dieses Bemühen dort, wo er versucht, die gegensätzliche Entwicklung der gesellschaftlichen Implementierung tiefenpsychologischen Denkens und Handelns in den mitteleuropäischen und angloamerikanischen Gesellschaften nachzuzeichnen.
In Mitteleuropa, wo die Psychoanalyse entstand, forderte sie die dort noch intakte patriarchale Ordnung heraus. (...) In den konservativen Demokratien Englands und der Vereinigten Staaten der Nachkriegszeit dagegen spielte sie eine ganz andere Rolle: Hier trug sie dazu bei, dass die Psychotherapie sich stärker an der Medizin ausrichtete und Macht und Autorität stärker unter psychologischen Voraussetzungen betrachtet wurden. Im ersten Fall gehörte sie zu den Kräften, die die Demokratisierung voranbrachten, im zweiten Fall wurde sie tendenziell zu einem Agenten der sozialen Kontrolle.
Den Ausgangspunkt für diese gegensätzliche Entwicklung verortet Eli Zaretsky bereits in den frühen Abspaltungstendenzen, die er neben persönlichen Differenzen zwischen Freud und seinen Schülern weitgehend als Folge der schwierigen Positionierung der Psychoanalyse angesichts der traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs ausmacht. Dieses Ringen um eine gesellschaftliche Positionierung zwischen Vereinnahmung und Marginalisierung fand im opportunistischen Verhalten vieler Analytiker - und nicht zuletzt von Freud selbst - gegenüber dem Nationalsozialismus seinen traurigen Höhepunkt.
Ein Standardwerk?
Es ist die hervorragend recherchierte, im besten Sinne nüchterne und sachlich fundierte Darstellung der hochambivalenten gesellschaftspolitischen Rolle der Tiefenpsychologie von den Anfängen bis in die Gegenwart, die "Freuds Jahrhundert" zu einem unverzichtbaren Beitrag zur allzu oft tendenziös geführten einschlägigen Debatte macht. Im Übrigen ist der Band äußerst sorgfältig editiert. So sehen gelungene Sachbücher von heute aus, die das Zeug haben, morgen schon Standardwerke zu sein.
Mehr zu Freud in science.ORF.at
Hör-Tipp
Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr
Download-Tipp
Ö1 Club-DownloadabonenntInnen können die Sendung nach der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.
Buch-Tipp
Eli Zaretsky, "Freuds Jahrhundert. Die Geschichte der Psychoanalyse", übersetzt von Klaus Binder und Bernd Leineweber, Zsolnay Verlag, ISBN 3552053727
Links
Sigmund Freud Museum Wien
Freud-Institut