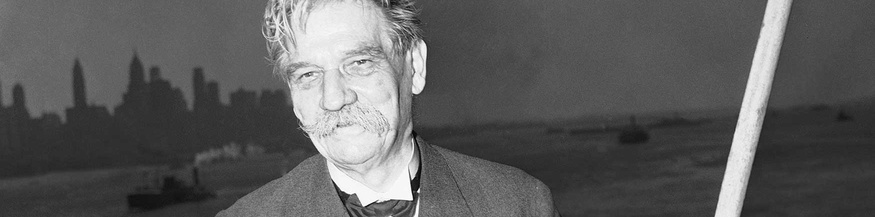Nicht immer tödlich
Sepsis
Die Sepsis gehört noch immer zu den gefürchtesten Komplikationen einer Infektion. Dank wissenschaftlicher Forschungen der letzten Jahre, steht der modernen (Intensiv-)Medizin ein breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.
8. April 2017, 21:58
In der Bevölkerung ist das Wissen um die Blutvergiftung eher gering. Viele setzten die Diagnose "Sepsis" einem Todesurteil gleich. Dabei gibt es auch weniger dramatische Stadien der Sepsis, bei denen die Heilungsrate sehr hoch ist.
Das Risiko zu erkranken
Grundsätzlich kann jede Infektion zu einer Sepsis ausarten. Gott sei Dank kommt es jedoch - in Relation zur Häufigkeit von allgemeinen Infektionen wie z. B. einer Harnblasenentzündung - nur selten zu einer Blutvergiftung. Ein erhöhtes Risiko haben ältere Personen und jene, bei denen das Immunsystem geschwächt ist. Darüber hinaus gibt es Erreger, die höchst aggressiv sind und auch bei jungen, gesunden Personen im schlimmsten Fall zum Tod führen können.
Invasion der Erreger
Die Eintrittspforten für Erreger sind vielfältig. So können sie z. B. über die Nasenschleimhäute eindringen oder über eine offene Wunde. Besonders hartnäckig, weil resistent gegen viele Antibiotika, sind Keime, mit denen sich Patienten im Krankenhaus infizieren, so genannte nosokomiale Keime.
Bei der Sepsis breitet sich eine zunächst örtlich begrenzte Infektion - manchmal innerhalb weniger Stunden - über den gesamten Körper aus. In diesen Fällen hat es das Immunsystem nicht geschafft, die Infektionsquelle rechtzeitig zu beseitigen. Sind die Erreger einmal über die Blutbahn in den Körper gelangt, wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt.
Vorgänge im Körper
Um gegen unliebsame Eindringlinge vorgehen zu können, aktiviert der Organismus sein Abwehrsystem. Zunächst aber wird der betroffene Bereich vermehrt durchblutet. Es kommt zu einer Erwärmung der Stelle. Diese Infektionen gehen mit typischen Symptomen wie z. B. Schmerzen, Fieber, einer Rötung und Schwellungen einher.
Hat sich der Erreger bereits über den Körper verteilt, arbeitet das Immunsystem zunächst auf Hochtouren. Es gilt ja nicht mehr nur eine "kleine" Infektion zu besiegen, sondern der gesamte Körper wird als "Kriegsschauplatz" angesehen. Nach einiger Zeit kommt das Immunsystem total zum Erliegen. Welche Faktoren zu diesen Reaktionen führen, ist noch nicht restlos geklärt.
Der septische Schock
Bei den fortgeschrittenen Stadien einer Sepsis fällt der Blutdruck in den Keller. Die Herzfrequenz steigt. Organe versagen, weil sie nicht mehr ausreichend versorgt werden. Im schlimmsten Fall bricht auch der Kreislauf zusammen.
Symptome und Diagnose
Am Beginn dieses Prozesses sind die Symptome in der Regel harmlos und ähneln einem grippalen Infekt, äußern sich also durch z. B. Halsschmerzen, Fieber usw. Dies ist auch der Grund dafür, warum eine Sepsis viel zu häufig erst in einem lebensbedrohlichen Stadium diagnostiziert wird.
Symptome alleine reichen nicht aus, um eine sichere Diagnose stellen zu können. Es bedarf auch Laboruntersuchungen des Blutes. Vermehrtes Auftreten von Leukozyten etwa, kann ein Hinweis sein. Außerdem ist bei Betroffen oft die Herz- und Atemfrequenz erhöht. Bildgebende Verfahren können dabei helfen, die Ursprungsquelle ausfindig zu machen.
Therapie
Oberstes Gebot bei der Therapie ist rasches Reagieren, sodass die Maßnahmen auch schnell greifen. Denn eine Verschlechterung des Zustandes kann plötzlich eintreten, der Patient verstirbt - ohne entsprechende Gegenmaßnahmen - innerhalb weniger Stunden. In fortgeschrittenen Stadien (bei der schweren Sepsis bzw. beim septischen Schock) müssen alle Maßnahmen genutzt werden, die der Intensivmedizin zur Verfügung stehen.
Allen voran wird versucht, die Erregervermehrung mit entsprechenden Medikamenten z. B. Antibiotika einzudämmen. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass die Vitalfunktionen nicht zusammenbrechen. Dagegen hilft z. B. die so genannte Volumentherapie. Sie hat die Aufgabe, den verminderten Blutdruck wieder zu stabilisieren. Zu einem Blutdruckabfall kommt es dann, wenn sich der Flüssigkeitshaushalt im Körper verschiebt. Außerdem können - je nach Bedarf - z. B. bestimmte Proteine, Immunglobuline oder humane Interleukin-1-Rezeptorantagonisten eingesetzt werden.
Eine neuere Errungenschaft in der Therapie ist ein Medikament, das den so genannten Protein-C-Spiegel (er ist bei vielen Patienten mit einem septischen Schock vermindert) wieder erhöht. Dieses Protein ist wesentlich an der Blutgerinnung beteiligt. Ist zu wenig vorhanden, kommt es leichter zur Blutgerinnung und zur Bildung von Thromben.
Leider ist der Einsatz dieses Medikamentes sehr teuer.
Diskutieren Sie mit!
Wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie während der Sendung unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 22 6979 an, oder posten Sie hier.
- Haben Sie Fragen zur Diagnose und Therapie einer Blutvergiftung?
- Leiden Sie oder jemand von Ihren Angehörigen unter "verdächtigen" Symptomen und sie wollen wissen, wie erst diese zu nehmen sind?
- Waren Sie selbst schon einmal betroffen, und möchten über ihre Erfahrungen sprechen?
Mehr zum Thema Sepsis in der Online-Infomappe
Hör-Tipp
Radiodoktor, Montag, 16. Jänner 2005, 14:20 Uhr
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendung nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.
Link
ÖGI