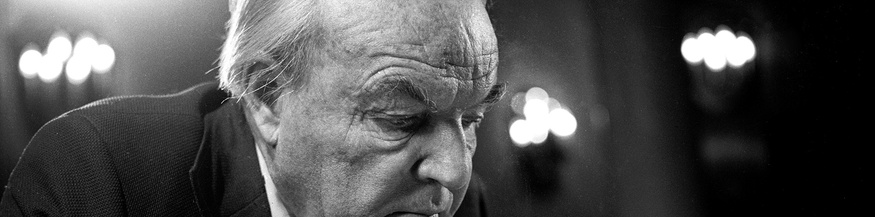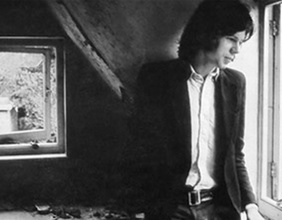Nestor Kirchner lehnt Freihandelszone ab
Argentinien-Krise ohne Ende?
Der Amerika-Gipfel in Mar del Plata bot dem argentinischen Präsidenten Kirchner eine Bühne: Sein Eintreten gegen die von Bush propagierte Freihandelszone von Alaska bis Feuerland kommt beim Wahlvolk gut an. Er interpretiert es als Überwindung der Krise.
8. April 2017, 21:58
Luis Mattini über Argentiniens Wirtschaftsmodell
Es war Anfang November dieses Jahres, als George Bush mit 32 amerikanischen Staatschefs zu einem Gipfeltreffen im argentinischen Badeort Mar del Plata zusammentraf, um über die Zukunft des Kontinents zu diskutieren. Der amerikanische Präsident wollte die Konferenzteilnehmer zur Verabschiedung eines Zeitplans überreden, wann Amerika - von Feuerland bis Alaska - in eine einzige Freihandelszone verwandelt wird. Doch es kam anders ...
"Bush: Raus aus Lateinamerika!"
Mit diesen und ähnlichen Sprechchören von etwa 20.000 Demonstranten geriet die Konferenz außer Kontrolle. Der venezolanische Staatschef Hugo Chávez rief dabei zum "Kampf gegen den Imperialismus" auf, darunter auch Fußballstar Diego Maradona, der den US-Präsidenten "einen Dreck" nannte. Auch im Konferenzgebäude stieß Bush nur auf Ablehnung. Die südamerikanischen Präsidenten zeigten sich erstmals geeint und lehnten das Vorhaben des "Großen Bruders" - den Gemeinsamen Markt - ab.
Washington müsse erst die Subventionen für die Landwirtschaft streichen, forderte Gastgeber Nestor Kirchner als Sprecher der Südamerikaner. Nach zehnstündiger Diskussion verabschiedete man eine Erklärung mit den gegensätzlichen Positionen, und George Bush reiste mit leeren Händen ab.
Kirchners Regierung auf dem Weg zur Normalität?
Mit dem aggressiven Auftreten wollte Nestor Kirchner auch innenpolitische Punkte sammeln, denn 80 Prozent seiner Landsleute verurteilen George Bush und seinen Krieg im Nahen Osten - und der argentinische Präsident sitzt zwar seit Mai 2003 fest im Sattel, aber die damaligen Wahlen waren - wie Luis Mattini, einer der wenigen unabhängigen Intellektuellen, betont - eher Protestwahlen gegen die herrschenden Zustände: Nur 70 Prozent gingen wählen, zehn Prozent stimmten ungültig. Das war für Argentinien, wo Wahlpflicht herrscht, mehr als ungewöhnlich:
"Die Menschen haben das geringere Übel gewählt. Der Schock der Wirtschaftskrise Ende 2001 saß ihnen noch im Nacken, als Bankkonten gesperrt sowie Löhne und Gehälter nicht mehr gezahlt wurden. Die soziale Situation im Land hat sich aber bisher kaum verbessert. Die Arbeitslosigkeit ist riesig, die soziale Schere zwischen Arm und Reich geht weit auseinander. Wer Unterschicht ist, bleibt Unterschicht und hat keine Aussicht auf sozialen Aufstieg".
Keine Alternativen in Sicht
Zweieinhalb Jahre ist nun die Kirchner-Regierung im Amt, und die anfängliche Begeisterung scheint vorbei. Die Löhne sind niedrig, die Inflation hat wieder angezogen, und Jobs sind rar. Die meisten Jugendlichen haben so existenzielle Probleme, dass sie Politik kaum zur Kenntnis nehmen. Oppositionelle Gruppen reizen sie nicht, die Rechten sowieso nicht, und die Linken haben in den untersten Schichten der Gesellschaft wenig Anhänger. Auch bei den Wahlen im Oktober ist keine der linken Parteien über die Drei-Prozent-Hürde geklettert. Mattini dazu:
"Es existieren eine Menge linker Parteien. Aber mehr Leute demonstrieren als die Linke Wählerstimmen hat. Es sind immer dieselben Köpfe, ohne glaubwürdige Alternativen. Sie vertreten eine andere Ideologie, aber keinen Weg, wie man dorthin gelangt. Und sie wenden dieselben miesen Praktiken wie die bürgerlichen Parteien an: Sie tricksen rum, manipulieren, lügen und benutzen die Sozialhilfe-Programme wie alle anderen Parteien, um mit der Not der Menschen Parteipolitik zu machen. In den Augen der Leute ist die Linke nicht nur unfähig und unprofessionell, sondern genauso korrupt wie alle anderen".
Armut regiert, wohin man schaut
Die Armut im Land wurde von der Kirchner-Regierung jedenfalls mit unlauteren Mitteln bekämpft. Heute leben allein in Buenos Aires 50.000 Familien von der Abfallwirtschaft. Eine Kooperative von Cartoneros - Lumpensammlern - wurde gegründet. Um zu überleben, wühlen sie in Mülltonnen. Die Kooperative zahlt jedem Mitglied monatlich 180 Euro.
Dennoch verlieren viele an der Armutsgrenze Lebende ihre Wohnungen, weil sie die Miete nicht bezahlen können. Tausende Gebäude in der Hauptstadt werden besetzt. Die Stadtverwaltung unterstützt die Armen zwar im Rahmen ihres Programms "Selbst-Anstellung" mit umgerechnet etwa 60 Euro pro Kopf und Monat, aber das bekommen nur diejenigen, die arbeiten.
Auch ein Heim für Straßenkinder, das einen privaten Träger hat, erhält von der Stadtverwaltung und dem Ministerium für sozialen Fortschritt eine feste Summe: "Die Behörden verwechseln jedoch Sozialarbeit mit Assistenzialismus, mit der Vergabe von Almosen. Sie glauben, wenn die Kinder ein Dach über dem Kopf, zu essen und was anzuziehen haben, sei das Problem gelöst. Wir wollen aber den jungen Menschen in die Lage versetzen, sich in seinem künftigen Leben zurechtzufinden. Dafür braucht er Ausbildung und Fürsorge. Dafür ist nie Geld da", sagt die Leiterin dieses Heims.
Korruptionsverdacht gegen Regierung immer stärker
Inzwischen mehren sich auch die Gerüchte um mögliche Korruption seitens der Regierung. Der schwerwiegendste Vorwurf betrifft das Verschwinden einer halben Milliarde Dollar aus der Staatskasse der Erdöl-Provinz Santa Cruz. Nestor Kirchner hatte, als er dort Gouverneur war, 529 Millionen Dollar auf Luxemburger und Schweizer Konten überwiesen. Kirchner behauptet, er habe auf diese Weise das Geld vor der Abwertung gerettet. Er sagt aber nicht, wo dieses Vermögen von Santa Cruz lagert, welche Zinsen gezahlt werden und wer es verwaltet. "Ein Fall für den Staatsanwalt", meint Rechtsanwalt Monner Sans. Aber der neue Generalstaatsanwalt heißt Esteban Righi, ist Peronist und seit Jahren Vertrauensanwalt des Ehepaars Kirchner. Monner Sans dazu:
"Er hat tausend Mal versprochen, diese Gelder wieder nach Argentinien zu bringen. Das ist bis heute nicht geschehen. Außerdem: Wie kann er Investitionen fordern, wenn er öffentliche Finanzmittel im Ausland anlegt?"
Das Land ist jedenfalls weit von der Normalität entfernt. Das Vertrauen in die Regierung ist getrübt, für viele kaum oder gar nicht vorhanden. Die Argentinier warten ab, ziehen das kleinere Übel vor, weil sie schon Schlimmeres durchgemacht haben. Aber werden sie sich mit diesem Zustand auf Dauer abfinden?
Mehr zum Thema Politik in Ö1 Inforadio
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendung nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.
Link
Wikipedia - Argentinien-Krise