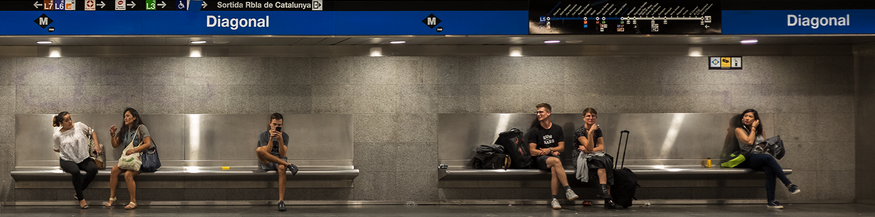Ein Hauch von Mystik
Fragmente in der Oper
Gibt es Opern, die unvollendet vollendet sind? Bühnenwerke, die von ihren Schöpfern streng genommen als Fragmente hinterlassen wurden, die aber doch bereits als vollwertiges Ganzes wahrgenommen werden können?
8. April 2017, 21:58
Rund um die von der Witwe des Komponisten Alban Berg öffentlichkeitswirksam befehdete - vom Verlag des Komponisten geförderte - Vollendung von Bergs Oper "Lulu durch Friedrich Cerha in den 1970er Jahren wurde diese Debatte besonders heftig geführt. Heute führt die puristische zweiaktige Version der "Lulu weiter ihr Bühnenleben neben der nach Bergs Particell ergänzten Langversion des dritten Aktes.
Keine Lust auf ein Ende?
Opernfragmente, die später andere Musiker und Musikwissenschaftler zu Fertigstellungsversuchen angeregt haben, gibt es auch von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie stammen bei ihm alle aus der Umbruchszeit des "Idomeneo über die "Entführung aus dem Serail bis zum "Figaro. Dabei bieten sie beste Musik und teils anfechtbare Texte, deretwegen Mozart diese Arbeiten auch unvollendet liegen ließ.
Schwierigkeiten ohne Ende?
Ähnliche Gründe haben bei Georges Bizet ("Ivan IV), Gaetano Donizetti ("Le duc dAlbe) oder - viel später - Alexander Zemlinsky ("Der König Kandaules) dazu geführt, dass Kompositionen nicht zu Ende geführt wurden: Schwierigkeiten mit den Librettisten, Schwierigkeiten mit den Auftrag gebenden Opernhäusern, Schwierigkeiten mit den Sängerbesetzungen - stets aber waren früher oder später die nachgeborenen Vollender zur Stelle und haben auch aus diesen Werken spielbare Fassungen erstellt.
Unerwartetes Ende?
Zu den berühmtesten unvollendeten Opern des 20. Jahrhunderts gehört Giacomo Puccinis "Turandot. Der Tod nahm dem Komponisten die Feder aus der Hand, ehe er das Finale zu Ende komponieren hätte können. Franco Alfano besaß das Vertrauen der Puccini-Familie und des Puccini-Verlegers, um nach Puccinis Skizzen der bestehenden Partitur weitere 25 Minuten hinzuzufügen - die ihm dann der Uraufführungsdirigent Arturo Toscani um knapp die Hälfte kürzen sollte.
Erst vor wenigen Jahren wurde öffentlichkeitswirksam eine weitere "Turandot-Finalversion vorgestellt, die aus der Feder von Luciano Berio stammt. Die zu Puccinis Zeit ohnehin modernen Musik versah er mit noch einer zusätzlichen Prise heutiger Modernität.
Buch-Tipp
"Das Fragment im (Musik-)theater. Zufall und/oder Notwendigkeit? - Vorträge und Gespräche des Salzburger Symposions 2002", Verlag Mueller-Speiser, ISBN 3851450876