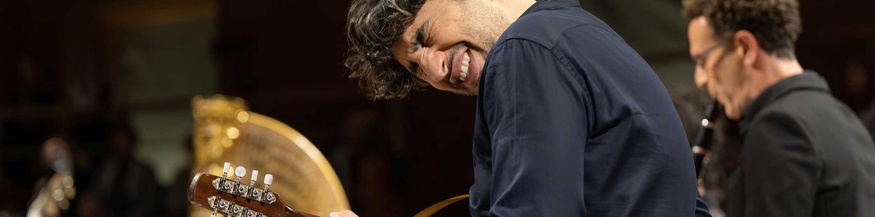Zwischen Rebellion und Assimilation
Jugendkulturen und so
Was ist "Jugend" eigentlich? Oder gar "Jugendkultur"? Das, was Jugendliche von ihren Eltern unterscheidet, könnte man sagen. Oder: Das, was Eltern nicht verstehen, und daher dagegen sind. Martin Blumenau macht sich so seine Gedanken.
8. April 2017, 21:58
Es gibt beeindruckende Fachleute, die mir erklären können, dass der Begriff "Kindheit", so wie wir ihn heute verstehen und anwenden, ein neuzeitliches Konstrukt mit einer menschheitsgeschichtlich geradezu läppischen Laufdauer von nicht einmal 250 Jahren sei. Zum Begriff Jugend, oder noch schlimmer Jugendkultur, befragt, lächeln diese klugen, in größeren Maßstäben denkenden Herren dann nicht einmal gequält.
Geprägt von Jazz, Rock'n'Roll und Pop
Nun gibt es die "Jugend" als Begriff auch schon seit etwa Nestroys Zeiten, er dient aber ausschließlich als Projektionsfläche für einander eigentlich ausschließende Ideen. Entweder ist/war Jugend rebellisch im bösen Sinn, halbstark und verwahrlost, oder sie revoltiert - quasi körperlich - als eine auch von reifen Deppen und Deppinnen, die nicht älter werden wollen, erstrebenswerte Lebensform, dem Jugendwahn.
Die "Jugendkultur" nun ist in diesem zeitlich jungen und engen Feld wiederum nur eine Detail-Ausprägung, die ursprünglich und immer noch dominant von der neuen Musik des 20. Jahrhunderts geprägt wurde: Jazz, Rock'n'Roll, Pop.
Bei "Negermusik-Apologeten" und "Rock-Rabauken" waren die gesellschaftlichen Abwehrmaßnahmen noch relativ simpel zu setzen, dann aber, ab den 60ern, überforderte die Vielfältigkeit der musikalischen Entwicklungen und Genres (und Sub-Genres) die in ihren Schwarz-Weiß-Mustern gefangene damals gebräuchliche Weltsicht, bis schlussendlich ab (allerspätestens) den 90ern jegliche als Jugendkultur verdächtige Äußerung sicherheitshalber sofort zu assimilieren war.
Das Dilemma der "heutigen Jugend"
In diesem Dilemma bewegt sich die "heutige Jugend". Versetzen Sie sich einmal in diese so gut wie aussichtlose Lage: Ein junger Mensch, von seltsamen körpereigenen Substanzen gebeutelt, von einem fremdbestimmten Leben geschüttelt, von einer unverständlich materialistischen Welt gefrozzelt, findet etwas, was seine/ihre innersten Gefühle anspricht, und das im besten Fall das Gegenteil von dem, was Sie repräsentieren, darstellen soll.
Sie aber sind, aufgrund ihrer gediegenen Pop-Sozialisierung und womöglich noch darüber hinausgehender Beschäftigung, mit allen Jugendkultur-Wassern gewaschen, kennen die Mechanismen, verstehen die Wichtigkeit von Codes, haben Zeichen und Gesten kapiert und finden womöglich auch noch die Musik, die die Peer-Group des Sprösslings anschleppt, ganz cool.
Im schlechten Fall überhäufen Sie die Armen auch noch mit Vorwürfen der Marke du-bist-so-unpolitisch. Dabei gehört der Jugendliche, der etwas tut, der mit offenen Augen herumläuft und alles als interessant Erspähte Spongebob-artig aufsaugt, eh schon zu einer qualitativ hoch qualifizierten Minderheit, der ob ihrer Fähigkeit, ebenjene Tools zu bedienen, die Welt offen stehen wird. Mehr als fünf Prozent - behaupte ich jetzt - sind das nicht.
Hohe Latte 68er
Die Ausnahme-Situation der einerseits hochgespielten, andererseits auch wirklich wichtigen und verändernden 68er-Bewegung, der Jugendkultur zwischen rebellischer Rockmusik, neuen Drogen und naiven Ideologie-Vorstellungen, hat allem, was danach kommen musste, die Latte zu hoch gelegt. Die Wucht der ersten Welle war nicht mehr zu toppen.
Die Punk-Rebellion gegen die Hippies oder die Revolte von Elektronik und HipHop gegen vorhersehbare weiße Pop-Muster hatten zwar hohen künstlerischen, aber kaum noch gesellschaftspolitischen Wert. Natürlich auch, weil die Vereinnahmungsmechanismen immer schneller greifen, seit der letzten Rock-Heiligsprechung - der von Kurt Cobain - fast schon automatisiert ablaufen.
Dagegen und dafür, und das gleichzeitig
Mittlerweile ist Jugendkultur im weiteren Sinn überall und alles. Und komplett entideologisiert. Das neue China, das sich ausschließlich auf seine Jugend stützt, lebt dieses Modell der Omnipräsenz clever vor: Alles für die Jungen, solange sie am Prozess teilnehmen. Je größer der Input, desto wichtiger werden die popkulturellen Massenphänomene, bis sie den Mainstream ersetzt haben.
Mit dem Modell der Jugendkultur im engeren Sinn hat das wenig zu tun. Die folgt, zumindest im europäisch-angloamerikanischem Kulturkreis, wo sie Zeit und Muße hat, einer anderen Maxime: Sie ist gleichzeitig dagegen und dafür. Sie muss einerseits strikt gegen etwas sein. Im Fall der entwicklungsorientierten Jugendkulturen ist das meist der Mainstream, manchmal sogar spezielle Entwicklungen darin, im Fall der rückwärts-orientierten, autistisch agierenden Jugendkulturen ist es, ganz radikal, einfach gleich alles andere. Andererseits steht die Bewegung aber auch für etwas, für die Codes, Zeichen und Äußerungen dieser Gruppe, eben ihre Einzigartigkeit.
Die Kultur der Jugendkulturen
Diese beiden konträren Denkansätze sind für den rationalen Erwachsenen schwer unter einen Hut zu kriegen. Für den vorher angesprochenen gebeutelten, geschüttelten und gefrozzelten Fünf-Prozent-Jugendlichen, der die Basis dieser Kulturen darstellt, ist das - gleichzeitig dafür und dagegen zu sein - ein Klacks.
Diese Tücke der menschlichen Entwicklungsbiologie ist die einzige Hoffnung auf ein Fortbestehen einer Kultur der Jugendkulturen, wie sie in den 40ern mit den Jazzheads, den 50ern mit den Beatniks und Rockabillys begonnen haben: ein untrügliches Gespür für die Ambivalenz und den Widerspruch (im doppelten Wortsinn) und die Fähigkeit, etwas draus zu machen. Dass dieses Schaffen wiederum in den meisten Fällen blitzeschnell vom Assimilierungsmoloch aufgesogen wird, erscheint wahrscheinlich auch denen, die drüber reflektieren, störender als denen, die's machen.
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendung nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich runterladen.
Buch-Tipp
Christiane Tramitz, "Kindergeheimnisse. Die verborgenen Welten der Elf- bis Achtzehnjährigen", Droemer Verlag, ISBN 3426272814
Mehr dazu in oe1.ORF.at