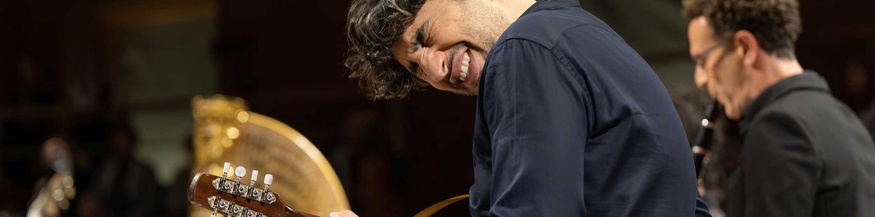EU-Schonfrist bis 2007 verlängert
Europas Stiefel wird enger
Während Deutschland und Frankreich Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung zeigen, rutscht Italien in eine veritable Rezession. Was sind die Gründe für die anhaltend schlechte Wirtschaftslage unseres südlichen Nachbarn?
8. April 2017, 21:58
Michael Pötscher zu Italien als Handelspartner
Auf einem Titelblatt des britischen Wirtschaftsmagazins "Economist" wird der Stiefelstaat von Krücken gestützt; dazu die Aufschrift: "The real sick man of Europe - der wahre kranke Mann Europas". Das ist keine Provokation, sondern eine Diagnose, die sich mit Zahlen belegen lässt. Denn Italiens Wirtschaft befindet sich seit dem Ende des letzten Jahres in der Rezession.
Der Schwächste unter Schwachen
Während Deutschland und Frankreich geringe Wachstumsraten vorausgesagt werden, kommt Italiens Wirtschaft nicht und nicht auf die Beine. Auch im ersten Quartal 2005 ist in Italien das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent gesunken. Für das Gesamtjahr 2005 wird mit einer Stagnation gerechnet.
Italiens Staatsschuldenberg ist mit 107 Prozent des Bruttoinlandsproduktes noch immer der höchste Europas, seine Wettbewerbsfähigkeit liegt nach einer Studie der OECD auf dem letzten Rang in der Eurozone und auf Platz 47 in der Welt. Dazu kommt das chronische Budgetdefizit unseres südlichen Nachbarn, der seit 2002 über der im Euro-Stabilitätspakt erlaubten Grenze von drei Prozent lag.
EU-Defizitverfahren eingeleitet
Eine Rechnung für die desaströse wirtschaftliche Situation Italiens wurde dieser Tage bereits von Brüssel vorgelegt. Die EU-Kommission hat ein Defizitverfahren eingeleitet. Mit einer Neuverschuldung von mindestens 3,6 Prozent in diesem und bis zu fünf Prozent im kommenden Jahr sprengt das Land selbst den reformierten Stabilitätspakt bei weitem. Dennoch wurde auf Drängen von Wirtschaftsminister Domenico Siniscalco eine Schonfrist bis 2007 gewährt, um den Haushaltsschaden zu sanieren.
Politische Versäumnisse
Als Ursache für das derzeitige Desaster sieht das britische Wirtschaftsmagazin "Economist" politische Untätigkeit. Ministerpräsident Berlusconi hat - so wird argumentiert - zu viel mit seinen Rechtsstreitigkeiten zu tun, als sich ausreichend um die Wirtschaft kümmern zu können. Außerdem ist der politische Einfluss in Unternehmen, an denen der Staat Anteile hält, noch immer zu groß.
Silvio Berlusconi selbst ist jedenfalls bislang nicht durch besondere Besorgnis aufgefallen. Ein neues Sparpaket schließt er vorerst aus, und auch sonst hält er für die Krise recht einprägsame Erklärungen parat: "Was soll man erwarten, wenn das Osterwochenende in den März fällt", kommentierte er im April die Rezessionsdaten, und erst unlängst versuchte er mit dem Hinweis zu beruhigen, dass Italiens Wirtschaft stabil sei, weil sie ja zu 40 Prozent auf dem Schwarzmarkt blühe.
Der Kassandra-Ruf des Präsidenten
Staatspräsident Carlo Azeglio Ciampi, ehemaliger Notenbankchef und in der Materie durchaus bewandert, hält es hingegen für angebracht, der Regierung ein Jahr vor den Parlamentswahlen den Ernst der Lage zu verdeutlichen:
"Die Politik muss Programme für das letzte Jahr der Legislaturperiode entwickeln, so als ob es das erste der neuen wäre. Ich weiß, das ist nicht leicht. Doch der Zustand unserer Wirtschaft verlangt es. Wir können nicht zwölf Monate verstreichen lassen, ohne mit Entschlossenheit zu handeln".
Trotz dieses Appells mag niemand daran glauben, dass Italiens politisches Management in zwölf Monaten nachholt, was sie in den letzten zehn Jahren versäumt hat. Denn obwohl die Begeisterung für das erreichte Ziel Europa anfänglich besonders groß war, wurde vergessen, das infrastrukturelle Rüstzeug für die neuen Zeiten zu entwickeln.
Die strukturellen Gegebenheiten
Vor allem Strukturprobleme sind es, die den Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsregionen behindern. Die meisten italienischen Unternehmen sind kleine Sachgüterhersteller, die der Konkurrenz der Tigerstaaten Asiens, aber auch jener des europäischen Marktes nicht gewachsen sind. Diese kleinen Familienunternehmen haben zu wenig Mittel, um ausreichend Forschung und Entwicklung zu betreiben. Im Schnitt sind in den italienischen Unternehmen nicht mehr als vier Personen beschäftigt.
Diese Struktur lässt auch wenig Spielraum für die Steigerung der Produktivität. Dazu kommt, dass Italiens Industrie nach wie vor in den traditionellen Branchen Textil, Bekleidung, Leder und Schuhen engagiert ist - Branchen, die lohnintensiv sind und daher aus anderen EU-Staaten längst in die Schwellenländer abgewandert sind. Während etwa seit 1999 in Deutschland die Lohnstückkosten um zehn Prozent gesunken sind, haben sie in Italien um zehn Prozent zugenommen. Das erklärt auch die geringe Exportquote der italienischen Wirtschaft.
Traditionsreiche Defizite und Altlasten
Der Umstieg zur Europareife ist jedenfalls wirtschaftspolitisch noch nicht vollzogen, und seit der Abwertungstrick mit der schwachen Lira, die den Export stark macht, nicht mehr funktioniert, treten Italiens traditionsreichen Defizite im kontinentalen und vor allem im globalisierten Wettbewerb mit besonderer Schärfe zu Tage. Gianfranco Fabi, Vizedirektor des Wirtschaftsblattes "Il Sole 24 Ore" mit einer Liste von Versäumnissen:
"Es gibt ein Problem mit der Effizienz des öffentlichen Sektors. Das ist eine Altlast, die Italien höhere Kosten im Vergleich mit anderen Ländern verursacht. Es gibt das Problem mit der öffentlichen Verwaltung, die den Bedürfnissen des Landes und seiner Unternehmen häufig im Wege steht. Nicht nur die Steuerbelastung ist hoch, schwierig ist auch ihre bürokratische Bewältigung. Italien ist das einzige Land, in dem man noch immer Schlange steht, um seine Abgaben zu zahlen, das ist absurd, zum Schaden kommt noch der Spott".
Lira-Nostalgie als Heilmittel?
Viele Defizite also, die Italien nicht aufarbeitet, auch weil es in sozialer Hinsicht relativ saturiert und unbeweglich ist. Es gibt keine großen Wachstumsimpulse, und das steht etwas im Widerspruch zum Image der Kreativität, die es wohl noch gibt, die aber immer mehr zur Ausnahme wird. Daher machen sich immer mehr grenzüberschreitende Geschäftemacher allmählich Sorgen um ihren strauchelnden Mitbewerber; auch Michael Pötscher, Leiter der österreichischen Außenhandelsstelle in der Wirtschaftsmetropole Mailand (mehr dazu im Audiofile).
Und so bleibt wohl alles beim Alten: An einem ganz normalen Geschäftstag werden im Lira-Einkaufsmarkt am Mailänder Stadtrand 600.000 Lire kassiert, an Wochenenden bis zu drei Millionen. Dass der teure Euro und die herrschende Rezession vielen Kunden die Konsumlaune gründlich verdorben hat, merkt hier zwar jeder Geschäftsmann - trotz preiswerter Hemden und Hosen mit dem italienischen Original-Design aus fernöstlicher Produktion; jeder Zugewinn in Lira ist ihm aber mit oder ohne Politik willkommen: Lira-Nostalgie als einträgliches Heilmittel gegen grassierende Konkunkturschwäche. Ein schönes Beispiel für kreative Krisenbewältigung made in Italy.
Mehr zum Thema Wirtschaft in Ö1 Inforadio
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendung nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.
Links
Financial Times - Italiens Wirtschaft
bpb - Bundeszentrale für politische Bildung