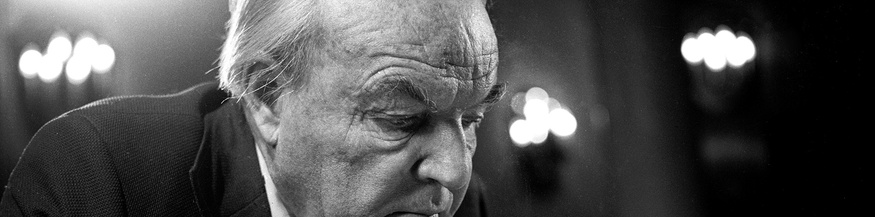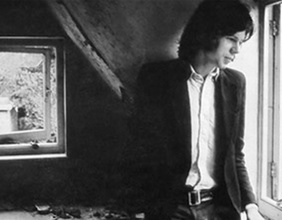Vorurteile und Urängste zweier Volksgruppen
Die "Schilder-Bürger"
Die Kärntner Slowenen werden meist nur in Zusammenhang mit zweisprachigen Ortstafeln wahrgenommen. Wie aber leben sie als Minderheit? Was sind ihre Urängste, welche Vorurteile bestehen zwischen ihnen und den Deutsch-Kärntnern?
8. April 2017, 21:58
Emil Kristof und sein "Aufklärungskoffer"
"Koroska inkognita - Unbekanntes Kärnten" - so nennt sich ein Projekt von Emil Kristof vom Klagenfurter Kulturverein Unikum, das er im Vorjahr gemeinsam mit anderen Künstlern zusammengestellt hat, um hartnäckige Vorurteile gegen Kärntner Slowenen zu persiflieren. Denn in dem Land, wo so gar nicht germanische Namen wie Sablatnik, Puschnig, Glantschnig, Plassnik oder dergleichen vorherrschen, bewegt die Frage Slowene oder Deutsch-Kärntner nach wie vor die Gemüter.
Historisch bedingte Vorurteile
Ein Grund für die Unstimmigkeiten beider Volksgruppen liegt u. a. in der Jahrhunderte langen gemeinsamen Geschichte. Einige wollen keinesfalls Gras über die letzten 85 Jahre wachsen lassen. Sie kreiden den Slowenen bis heute an, dass das Königreich der Serben, Slowenen und Kroaten nach dem Ersten Weltkrieg und das kommunistische Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg jeweils Teile Südkärntens annektieren wollten.
Beim Kärntner Abwehrkämpferbund unter Führung von Fritz Schretter herrscht daher nach wie vor die viel zitierte Urangst vor slowenischen Gebietsansprüchen. Wie er denken auch noch Kameradschaftsbund und Kärntner Heimatdienst. Hinzu kommt, dass es zahlreiche - auch so genannte zivile - Opfer auf beiden Seiten gegeben hat und dass weder die einen noch die anderen allein aus edlen Motiven gehandlet haben.
Ein slowenischer Pfarrer berichtet
Unter den damals Verfolgten war auch die Familie von Pfarrer Ivan Olip in Heiligengrab bei Bleiburg im Bezirk Völkermarkt, mitten im zweisprachigen Gebiet also. Er meint, im Krieg sei es schon sehr schlimm gewesen; heute aber funktioniere das Zusammenleben mit der deutschsprachigen Mehrheit:
"Gesungen wird in Heiligengrab ausschließlich Slowenisch, gebetet fast nur Slowenisch. Ich richte mich in jeder meiner acht Kirchen, die ich zu betreuen habe, nach der Sprache der jeweils Anwesenden".
Für die Pflege der slowenischen Sprache ist die Katholische Kirche von Völkermarkt im Südosten Kärntens entlang der Südgrenze zu Slowenien bis 20, 30 Kilometer westlich von Villach nach wie vor von großer Bedeutung. Als hilfreich erweist sich dabei - so Olip -, dass es genug slowenische Priester gibt, weil die Volksgruppe ihre männlichen Hoffnungsträger früher gern ins Priesterseminar geschickt hat.
Die Charme-Offensive des Bernard Sadovnik
Jahrzehnte lang haben für die Kärntner Slowenen zwei große Gruppen gesprochen - der links orientierte Zentralverband und der katholisch geprägte Rat.
Seit kurzem gibt es aber auch noch die Gemeinschaft der Kärntner Slowenen unter Bernard Sadovnik. Er hat sich vom Rat abgespalten - so seine Sicht - bzw. wurde von der Spitze des Rates weggeputscht, weil er gegenüber der Landespolitik zu konziliant war - so die Sicht anderer. Vom Ansatz her ist der christlich geprägte Sadovnik Pragmatiker. Sadovnik will für die Volksgruppe nichts juristisch erstreiten, sondern setzt eher auf eine Art dauerhafte Charme-Offensive gegenüber der Mehrheit - etwa mit Schnuppersprachkursen für die Kärntner Exekutive.
Der Ortstafelstreit
Auch wenn laut jüngster Umfrage mittlerweile zwei Drittel der 550.000 Kärntner zusätzliche zweisprachige Ortstafeln befürworten, hat der Abwehrkämpferbund mit seinen 10.000 Mitgliedern kürzlich wieder einen umfassenden Plan für mehr zweisprachige Schilder in letzter Sekunde platzen lassen. Ein Machtwort der großen Kärntner Parteien BZÖ und SPÖ blieb aus. Erklären kann das niemand. Die allermeisten Slowenen betrachten das als Skandal. Egal, in welchem Ausmaß sie sich zu ihrer Volksgruppe bekennen - dass man ihnen ihr Recht auf Ortsnamen verwehrt, lässt keinen kalt. Auch Rudi Vouk vom Rat der Kärntner Slowenen nicht, der auf mehr zweisprachige Ortstafeln besteht:
"Die Volksgruppe braucht diese Tafeln dringend als Signal nach innen, um die eigene Sprache nicht länger gering zu schätzen", argumentiert der Anwalt, der das Recht auf mehr Ortstafeln via Verfassungsgerichtshof erkämpft hat. Werde dieses Recht weiter verwehrt, schreite auch die Assimilation weiter voran, meint Vouk.
Die Urängste der Slowenen und Kärntner
So viel wie möglich Slowenisch reden mit ihren fünf Kindern ist die Devise von Ludwig und Pepca Druml aus dem verschlafenen Feistritz im Gailtal. Sie renovierten aufwändig das alte Dorfwirtshaus und bauten es zu einem Seminar- und Kulturzentrum aus. Beide versuchen auf ihre ganz persönliche Art, der fast verschwundenen slowenischen Sprache und Kultur im Ort wieder neues Leben einzuhauchen, eine Einstellung, die Pfarrer Olip in Bleiburg - also am andern, am östlichen Ende des gemischtsprachigen Gebietes - in helles Entzücken versetzen würde. Denn schlimmer als alles, was die deutschsprachige Mehrheit der slowenischen Minderheit heute noch nicht zugestehen mag, ist für ihn die Vernachlässigung des Slowenischen in den Familien.
Wenn man so will, spricht da aus Pfarrer Olip die slowenische Form der Kärntner Urangst, die Angst vor Assimilation, die Angst vor dem endgültigen Verstummen der eigenen Sprache. Und schaut man auf die Zahlen, ist diese Angst durchaus begründet: Ende des 19. Jahrhunderts hat noch mehr als ein Viertel der Kärntner Bevölkerung Slowenisch gesprochen, heute geben gerade mal zweieinhalb Prozent Slowenisch als Umgangssprache an.
Mehr dazu in Ö1 Inforadio
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendung nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.
Link
Kärntner Slowenen - Informationsportal