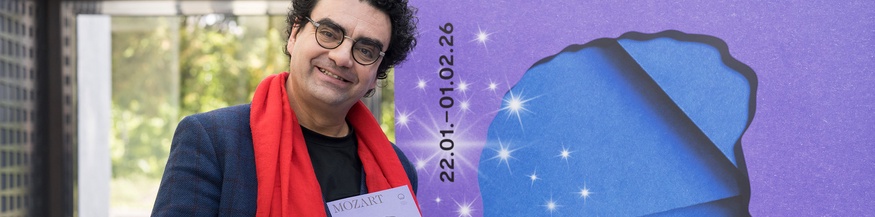Astronomische Kalender zur Bestimmung der Aussaat
Versunkene Observatorien
Die rund 250 Kreisgrabenanlagen Mitteleuropas beflügeln die Fantasie der Hobbyarchäologen, Heimatforscher und New-Age-Anhänger. Sie sind in kultureller Hinsicht ein einmaliges Phänomen, das von der Wissenschaft auf unterschiedliche Weise gedeutet wird.
8. April 2017, 21:58
Sie beflügeln die Fantasie der Hobbyarchäologen, Heimatforscher und New-Age-Vertreter. Wissenschaftlich werden sie kontrovers diskutiert, kulturell sind sie ein einmaliges Phänomen, und mit freiem Auge in den seltensten Fällen sichtbar: Die rund 120 Kreisgrabenanlagen Mitteleuropas.
Mehr als die Hälfte dieser neolithischen Monumentalbauten liegen in Niederösterreich. Erst die Flugbildarchäologie hat ermöglicht, die Fülle und die Vielfalt der Kreisgrabenanlagen zu dokumentieren. Denn vor Jahrtausenden verschüttet, sind die Anlagen oft nur durch den veränderten Pflanzenwuchs über den Gräben aus der Luft erkennbar. Die ältesten der Anlagen werden heute auf das Jahr 4800 vor Christus datiert. Und für den knappen Zeitraum von 250 Jahren wurden über die neolithischen Kulturgrenzen hinweg Kreisgrabenanlagen in ganz Mitteleuropa errichtet. Von der Theiß bis zum Rhein, von der Donau bis zur Moldau sind diese Anlagen zu finden.
Rätselhafte Funktion
Fest stand, dass die Kreisgrabenanlagen immer am Rande der Siedlungen lagen. Welche Funktion diese Monumentalbauten aber für die Menschen des Neolithikums besaßen, war den Archäologen Jahrzehnte lang ein Rätsel. Um die Kreisgrabenanlagen als Viehställe zu benutzen, waren sie zu aufwendig gestaltet. Und auch die Theorie, dass es sich hier um neolithische Friedhöfe handelte, ließ sich archäologisch nicht bestätigen, da nur vereinzelte Gräber innerhalb der Anlagen gefunden wurden.
Was blieb war die These, dass die Toranlagen dazu gedient haben könnten, astronomische Phänomene zu markieren. Überprüft wurden die Toranlagen in Bezug zur Winter - und der Sommersonnenwende. Doch im Vergleich wichen die Ausrichtungen der Tore bis zu 40 Prozent von einander ab.
Astronomischer Kalender
Nicht zuletzt der spektakuläre Fund der um 3000 Jahre jüngeren Bronzescheibe von Nebra ermutigte Archäologen und Paläoastronomen, die neolithischen Anlagen neu zu sehen. Denn die Bronzescheibe von Nebra wurde als astronomischer Kalender identifiziert, der den Mond in Kombination mit den Pleiaden zeigte.
Winter und Sommersonnenwende wurden hier nicht nach der Sonnenlaufbahn sondern nach dem Planetenstand berechnet. Um die Funktion der Kreisgrabenanlagen umfassend zu erforschen, sammelten die Wissenschafter sämtliche zur Verfügung stehenden Daten.
40 Niederösterreichische Kreisgrabenanlagen wurden genau vermessen und kartographisiert. Es stellte sich heraus, dass 40 Prozent der Kreisgrabenanlagen nach astronomischen Gesichtspunkten ausgerichtete Tore haben.
Rekonstruktion des Sternenhimmels
Die Voraussetzung dafür war zu rekonstruieren, wie sich der Sternenhimmel den Menschen vor 6800 Jahren darstellte. Mit Hilfe von Computersimulationen erprobten die Wissenschafter nun unterschiedliche Perspektiven. Hier zeigte sich, dass die Toranlagen nach vier Sternen ausgerichtet waren, deren Stand sowohl die Sonnenwenden als auch die Tag und Nachtgleichen anzeigten.
Einer dieser Sterne steht im Bild des Orion: der Stern Riegel. In der Kreisgrabenanlage von Immendorf bei Hollabrunn ist er verbunden mit der südlichen Ausrichtung der Tore. Das Nordtor ist nach dem Stern Denep ausgerichtet. Das Osttor der Anlage orientierte sich am so genannten Heliakischen Aufgang der Pleiaden. Am Tag des Frühlingsbeginns standen die Pleiaden kurz vor Sonnenaufgang am Osthimmel. Bereits am folgenden Tage überstrahlte die Morgensonne den Pleiadenaufgang, und die Sterne verschwanden aus dem Blickfeld des Betrachters. Das Westtor hingegen war nach dem Stern Antares ausgerichtet.
Das Ende eines Kultes?
Dieser steinzeitliche Kalenderbau war für die Organisation das bäuerliche Leben wichtig. Denn damit konnten exakt die Daten für die Aussaat festgelegt werden. Welche kultischen Bedeutungen die Kreisgrabenanlagen im rituellen Leben der Dorfbewohner außerdem gehabt haben können, liegt im Bereich der Vermutung.
Und so unvermittelt die Kreisgrabenanlagen in der Kulturgeschichte Mitteleuropas auftauchten, so plötzlich verschwanden sie auch wieder. In der Mitte des 5. Jahrtausends vor Christus wurden die Anlagen entweder zugeschüttet - oder einfach aufgegeben und versandeten. Den Grund dafür kennen die Archäologen nicht.
Kreisgrabenanlage in Originalgröße rekonstruiert
In der Niederösterreichischen Landesausstellung 2005 am Heldenberg bei Kleinwetzdorf präsentieren die Archäologen ihre Forschungsarbeit der vergangenen Jahrzehnte. Im so genannten Steinzeitpark wurde eine Kreisgrabenanlage in Originalgröße rekonstruiert.
Archäologen, Astronomen und Computerspezialisten zeigen in der unterirdischen Ausstellungshalle ihre virtuelle Kreisgrabenwelt, die benutzt wurde, um die Ausrichtung der Tore auf Sonne Mond und Sterne zu beobachten. Doch die Forschung sei noch lange nicht abgeschlossen, meint Wolfgang Neubauer vom Institut für Geophysik an der Universität Wien,
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendung nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.
Veranstaltungs-Tipp
Niederösterreichische Landesausstellung "Zeitreise Heldenberg", 5. Mai bis 1. November 2005, Heldenberg bei Kleinwetzdorf
Ö1 Club-Mitglieder erhalten ermäßigten Eintritt.