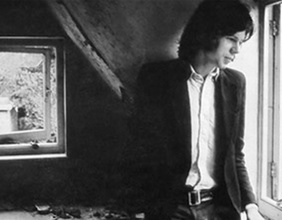Kritik mit Schmackes
Pauli, der Nobelrabauke
Vor 60 Jahren wurde der österreichische Physiker Wolfgang Pauli für die Entdeckung des so genannten Ausschlussprinzips mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Anlass genug, sich an seinen wunderschön uncharmanten Diskussionsstil zu erinnern. Eine Würdigung.
8. April 2017, 21:58
Weil im Jahr 2005 nur von Einsteins annus mirabilis die Rede ist: Heuer gibt es noch ein anderes Physik-Jubiläum, wenn auch kein ganz so großes. Vor 60 Jahren bekam der österreichische Physiker Wolfgang Pauli den Nobelpreis verliehen, und zwar für seine Entdeckung des so genannten Ausschlussprinzips aus dem Jahr 1923.
Bekannt ist Pauli auch für die Vorhersage eines Teilchens, das Enrico Fermi später als "kleines Neutron", Neutrino, bezeichnete. Die Vorhersage wurde nach 26 Jahren bestätigt, heute haben die Neutrinos einen Fixplatz in der Menagerie der physikalischen Teilchen. Soweit alles bekannt.
Jungstar
Um das Bild abzurunden, noch folgendes: Bereits als 21-jähriger Student schrieb Pauli einen Artikel über die Relativitätstheorie für die Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften, der später auch als selbständiges Buch erschien und zu einem echten Klassiker avancierte. Der Text gilt selbst heute noch als eine der besten konzisen Darstellungen der Einsteinschen Theorie von Raum, Zeit und Schwerkraft.
Pauli war also bereits als Junger ein Star in der Szene - und spätestens seit der Verleihung des Nobelpreises war auch außerhalb der Fachkreise klar: Er ist eines der ganz großen Kaliber unter den Physikern dieses Jahrhunderts. Max Born hat das einmal so ausgedrückt: "Ich wusste seit der Zeit, da er mein Assistent in Göttingen war, dass er ein Genie war, nur vergleichbar mit Einstein selbst, ja dass er rein wissenschaftlich vielleicht noch größer war als Einstein, wenn auch ein ganz anderer Menschentyp, der in meinen Augen Einsteins Größe nicht erreichte."
Genial, aber kein Charmebolzen
Was Born meinte: Pauli war nicht der nette, bescheidene Wissenschaftler, der auch als idealer Schwiegersohn durchgegangen wäre. Er war eher der zynische, unsportliche Typ. Pauli war sich seines überlegenen Intellekts voll bewusst - und er behielt das auch nicht für sich.
Manche legten das als Präpotenz aus, ihm Nahestehende wussten aber: Er ist zwar nicht "Prince Charming", meint es aber nicht persönlich. Sein jüngerer Kollege Viktor Weisskopf berichtete zum Beispiel einmal im "American Journal of Physics": "Die Zusammenarbeit mit Wolfgang Pauli war absolut großartig. Man konnte ihm jede Frage stellen. Und man brauchte keine Angst zu haben, dass er irgendeine besondere Frage für dumm halten würde, denn er hielt alle Fragen für dumm."
Meister verbaler Vernichtung
Solche Anekdoten über Pauli gibt es in jeder besseren Physikgeschichte des 20. Jahrhunderts nachzulesen, mein persönlicher Favorit ist jene, die einmal Emilio Segre, der Co-Entdecker des Antiprotons, erzählt hat: "Pauli hatte recht sonderbare Manieren. So zum Beispiel nahm er mich auf einer internationalen Tagung nach einem Vortrag, in dem ich meine Untersuchung der Protonen-Protonen-Streuung beschrieben hatte, beiseite und sagte: 'Ich habe noch nie eine schlechtere Rede als Ihre heutige gehört.' Dann dachte er einen Augenblick lang nach, wandte sich an einen dabeistehenden Kollegen und fügte an: 'Mit Ausnahme Ihrer Antrittsvorlesung in Zürich.'"
Rabaukentum: Bitte mehr davon
Diese verbale Links-Rechts-Kombination ist ein wunderschönes Beispiel der von Pauli begründeten Diskussionsschule, die heute leider ein wenig in Vergessenheit geraten ist.
Der 60. Jahrestag seiner Nobelpreis-Auszeichnung ist ein guter Anlass, sich nun seines Erbes zu besinnen: Forscher dieser Welt, wir brauchen mehr gepflegtes Rabaukentum in der Wissenschaft! Den Diskussionen auf faden Tagungen tut's gut, unterhaltsam ist es auch, und überhaupt: Freundlich ungenial sein kann ja jeder.