Der Siegeszug des Existenzialismus
Zur Freiheit verurteilt
Jean Paul Sartres Philosophie der Freiheit traf auch im zerstörten Österreich der Nachkriegsjahre das Lebensgefühl derer, die sich im Bewusstsein wieder fanden, noch einmal davongekommen zu sein. Wer seine Existenz gerettet hatte, konnte neu anfangen.
8. April 2017, 21:58
Echter als in Paris soll er gewesen sein, der "Strohkoffer", tagsüber Galerie und abends Treffpunkt von Schauspielern, Komponisten, Bildhauern, Schriftstellern. "Diskussion und Kritik erhitzen Gemüter und Geister", hieß es in einem zeitgenössischen "Wochenschau"-Beitrag.
Der in einer Seitenstraße der Kärntner Straße gelegene "Strohkoffer", der Anfang der 50er Jahre als perfekte Mischung von Club Saint-Germain-des-Pres und Cafe de Flore funktionierte, bot einen für Wien neuartigen Kontakt zwischen Künstlern wie Konrad Bayer, Oswald Wiener, Padhi Frieberger oder H. C. Artmann und Publikum.
Geistiger Hunger
Jeden Abend war das Lokal, das für sechzig Leute zugelassen war, gerammelt voll. Bei manchen Veranstaltungen, vor allem den musikalischen, standen die Besucher auf der Kellerstiege, bis hinauf auf die Straße. Zu später Stunde konnte es dann vorkommen, dass Friedrich Gulda Jam Sessions mit Uzzi Förster spielte.
Eine ganze Generation junger Menschen gab nach dem Krieg ihrem Lebensgefühl den Namen einer philosophischen Bewegung: Existenzialismus. Die jungen österreichischen Nachkriegsintellektuellen stillten ihren geistigen Hunger an Werken von Kafka bis Sartre.
Als "Dior der Philosophie" bezeichnete Wolfgang Kraus, ehemals Leiter der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, Jean Paul Sartre. Man wurde, erinnerte sich Wolfgang Kudrnovsky, intellektueller Gegenspieler von Wolfgang Kraus, so nebenher Existenzialist, weil da jemand auftrat, der Atheist war und so gar nichts mit dem alten Mief zu tun hatte.
Der Meister besucht Wien
Im Dezember 1952 war Sartre schließlich in Wien. Er hielt beim umstrittenen, weil von Kommunisten organisierten, "Wiener Kongress der Weltfriedensbewegung" eine Ansprache. Der spätere Volkstheater-Direktor Paul Blaha, laut Selbstbild Anfang der 50er Jahre "Existenzialist und bürgerlicher Liberaler, traf mit Sartre in einem Weinkeller zusammen:
"Er war imponierend, ruhig, still und durchdringend. Er hatte immer etwas Forderndes, auch wenn er einen angesehen hat durch diese dicken Brillen. Man hat immer das Gefühl gehabt, dass er sich sehr konzentriere. Er war in der Lage, einen kraft seiner Person sehr einzunehmen. Er war eine Persönlichkeit, trotz seines nicht sehr einnehmenden Äußeren."
Den kommunistischen Intellektuellen, die den Kongress von 1952 initiiert hatten, war es gelungen, weltweit eine beeindruckende Heerschar von Sympathisanten zu gewinnen. Lediglich zwanzig Prozent seien Kommunisten gewesen, versichert Simone de Beauvoir aufgrund der Angaben Sartres, der sich in Wien nicht nur wohl, sondern sogar "glücklich" gefühlt hat.
Sartres Eröffnungsrede im Konzerthaussaal
In einer seiner zahlreichen Erklärungen zählte Sartre drei Ereignisse auf, die ihm wieder Hoffnung gaben, es waren dies die Volksfront von 1936, die Befreiung und der Wiener Kongress. Diese Aussage fand der Publizist und Sartre-Kenner Michel Antoine Burnier drollig, "weil Sartre an der Volksfront nicht teilgenommen hat, er hat nicht einmal gewählt, gerade einmal hat er Streikenden etwas gespendet. 1936 war er völlig apolitisch. Auch an der Befreiung von Paris hat Sartre nicht teilgenommen. Mit dem Wiener Kongress hat er sich ein drittes Ereignis konstruiert, das gar nicht existierte. Dieser Friedenskongress war eine inszenierte Sache, mit falschen Demokraten, falschen Katholiken, falschen Gaullisten und so weiter. Eine völlig manipulierte Angelegenheit mit 80 Prozent Kommunisten".
Sartre hielt die Eröffnungsrede im Konzerthaussaal, und er tat sein Missfallen gegenüber der herrschenden Politik und dem Zeitgeist kund. Nichts besonders Aufregendes eigentlich, bloß gut gemeinte Bemerkungen im Sinne einer Ablehnung der Blöcke.
Eher wegen oder anlässlich des Wiener Kongresses machte Sartre eine symbolische Geste: Er legte sich eine Art Selbstzensur als Beweis dafür auf, dass seine Anwesenheit in Österreich keine formale war, sondern Ergebnis eines Nachdenkens, das tiefer ging als vermutet. Prompt verbot er die Aufführung von "Die schmutzigen Hände", die am Volkstheater geplant war.
Download-Tipp
Ö1 Club-Mitglieder können die Sendungen der Woche gesammelt jeweils am Donnerstag nach Ende der Live-Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.

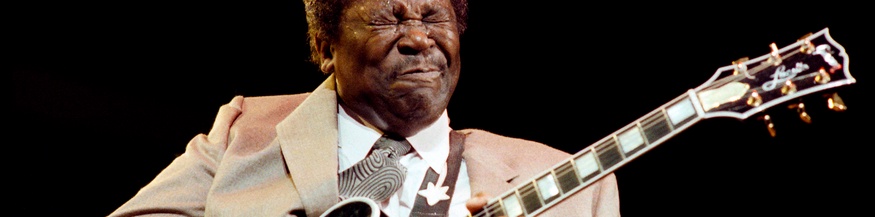

![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/2.0/DEED.DE|CC BY-SA 2.0] Ars Electronica Festival: Impressionen - Postcity](/i/related_content/be/0a/be0abe435ba816d5ee6c654aa7fcd6f770f4134e.jpg)
