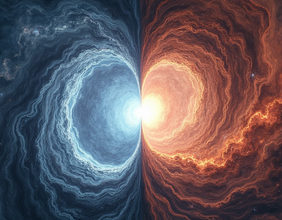Susan Sontags Vermächtnis
Worauf es ankommt
Als sie Anfang der 60er Jahre nach New York kam, schreibt Susan Sontag, hatte sie eine klare Vorstellung davon, was es bedeutet, Schriftstellerin zu sein. Diesem Anspruch des Schriftstellerin-Seins ist Susan Sontag bis zuletzt treu geblieben.
8. April 2017, 21:58
Die 41 Essays, die in "Worauf es ankommt" versammelt sind, zeigen eine enorme thematische Bandbreite. Mit Schriftstellern wie Danilo Kis, Witold Gombrowicz und W. G. Sebald setzt sich Susan Sontag ebenso einfühlsam-kritisch auseinander wie mit Roland Barthes, dem Bosnienkrieg und den Geheimnissen abendländischer Gartenbaukunst unter besonderer Berücksichtigung der künstlichen Grotte.
Wie wird man ein besserer Autor, eine bessere Schriftstellerin? Auch damit hat sich Susan Sontag, die akribische Selbsterforscherin, immer wieder beschäftigt. In einem ihrer Essays gewährt sie Einblick in ihre Autorinnenwerkstatt. Ihre These: Schreiben und Lesen seien voneinander nicht zu trennen, wer schreiben will, muss lesen!
Schreiben heißt, die Kunst des Lesens zu üben, und zwar mit besonderer Intensität und Aufmerksamkeit. Man schreibt, um das zu lesen, was man geschrieben hat, um zu sehen, ob es gut geworden ist, und, da das natürlich nie der Fall ist, um es umzuschreiben - einmal, zweimal, so oft wie nötig, damit etwas daraus wird, womit man beim Wiederlesen leben kann. Man ist sein eigener, vielleicht strengster Leser.
Paul Klee der Prosa
In einem der schönsten Essays des vorliegendes Bandes setzt sich Susan Sontag mit dem Schweizer Schriftsteller Robert Walser auseinander. Sie findet interessante Vergleiche für den großen, in den USA weithin noch unbekannten Dichter, der 1956 als Patient einer psychiatrischen Klinik starb.
Robert Walser ist ein Paul Klee der Prosa - ebenso zart, ebenso listig, ebenso gehetzt. Eine Kreuzung zwischen Stevie Smith und Beckett: ein gut aufgelegter, freundlicher Beckett.
Robert Walser als "gut aufgelegter Beckett": Wem solche Formulierungen gelingen, kann kein schlechter Autor, keine unbegabte Autorin sein, allen Selbstzweifeln zum Trotz. Susan Sontags Liebe zur europäischen Literatur klingt in vielen Texten an, kein Wunder, betrachtete sich Sontag selbst doch als die europäischste Autorin der US-amerikanischen Literatur.
Vorbehalte gegenüber der Fotografie
Susan Sontag gilt bis heute als eine der profiliertesten Theoretikerinnen der Fotokunst. Ihr Buch "Über Fotografie" ist sofort nach seinem Erscheinen zum Klassiker ernannt worden. Dabei habe sie sich selbst nie gern fotografieren lassen, gesteht Sontag in einem Aufsatz über den amerikanischen Schockfotografen Robert Mapplethorpe, der sie 1985 für seinen Bildband "Certain People" porträtiert hatte.
Und wie ich niemals fotografiert worden bin, ohne dabei ein ungutes Gefühl zu haben, so habe ich mir niemals das Ergebnis einer Fotositzung angesehen, ohne dabei peinlich berührt gewesen zu sein. Ist es ein puritanischer Vorbehalt gegenüber dem Simulieren, dem Posieren? Das alles vielleicht. Doch in erster Linie empfinde ich Bestürzung. Während mein Bewusstsein etwa zu neunzig Prozent denkt, dass ich auf der Welt bin, dass ich ich bin, denkt es zu etwa zehn Prozent, dass ich unsichtbar bin. Und dieser Teil ist entsetzt, wenn ich ein Foto von mir sehe.
Kein Stereotyp passt
Auf eine bestimmte Rolle wollte sich die Grande Dame der New Yorker Intelligenz nie festlegen lassen. Susan Sontag als kämpferische Menschenrechtlerin und Feministin, als kompromisslose Linke, als Hohepriestern der Avantgarde - das alles seien Stereotype und Klischees, mit denen sie immer wieder belegt worden sei.
Man kann Susan Sontags Essayband "Worauf es ankommt" wohl als eine Art Vermächtnis betrachten. Die Qualität der Texte ist durchaus unterschiedlich, nicht alle Aufsätze sind Perlen kritischer Essayistik, alles in allem aber bietet dieser Band doch faszinierende Einblicke in die Vielfältigkeit und die Spannkraft des Sontagschen Denkens und Schreibens.
Buch-Tipp
Susan Sontag, "Worauf es ankommt", aus dem Englischen von Jörg Trobitius, Hanser Verlag, ISBN 3446160191