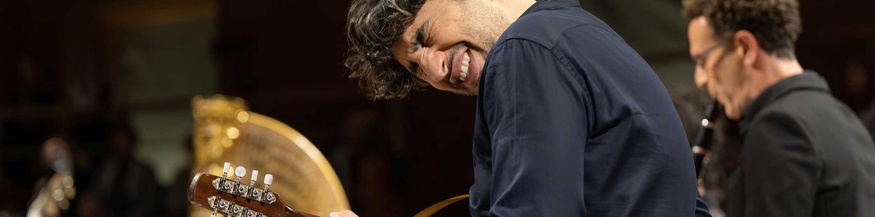Schach als Metapher
Bobby Fischer und der Kalte Krieg
David Edmonds und John Eidinow dokumentieren, wie Bobby Fischer 1972 in Reykjavik den damals amtierenden Weltmeister Spasski nicht nur in Grund und Boden gespielt, sondern auch die Schachwelt grundlegend verändert hatte. Und danach den Halt verlor.
8. April 2017, 21:58
Das letzte Foto von Bobby Fischer, das durch die Weltpresse ging, stammt vom 13. Juli des vergangenen Jahres. An diesem Tag wurde er auf dem Tokioter Flughafen fest genommen, weil er ohne gültigen Reisepass versucht hatte, aus Japan auszureisen. Fischer droht nun die Abschiebung in die USA, wo ihm ein Prozess bevorsteht, da er 1992 gegen das Embargo gegen Jugoslawien verstoßen hatte. Damals, mitten im Krieg auf dem Balkan, war er in Belgrad und auf der montenegrinischen Insel Sveti Stefan gegen ein angebliches Preisgeld von fünf Millionen Dollar noch einmal zu einem Schachturnier gegen Boris Spasski angetreten.
Mit 29 Jahren Schachweltmeister
Es hätte die glanzvolle Neuauflage der Weltmeisterschaft von 1972 sein sollen, bei der Fischer den damals amtierenden Weltmeister Spasski nicht nur in Grund und Boden gespielt, sondern auch die Schachwelt grundlegend verändert hatte. In Wirklichkeit war dieses Turnier nur eine der vielen Tragödien im Leben des Robert J. Fischer, der, nachdem er mit 29 Jahren Schachweltmeister geworden war, den Halt verlor, zu keinem internationalen Turnier mehr antrat, ziellos durch die Welt tingelte, von Zuwendungen lebte und von 1992 bis zu seiner Verhaftung untergetaucht war.
Ideologische Schlacht
Die Frage, ob Bobby Fischer normal sei oder nicht, stellte sich auch schon 1972, als er, der amerikanische Herausforderer, im isländischen Reykjavik den Weltmeister Boris Spasski aus der Sowjetunion zu besiegen gedachte. Und mit ihm die Sowjetunion und den Kommunismus. Die sowjetischen Spieler galten zu dieser Zeit als unschlagbar, die Weltmeisterschaft machten sie seit jeher unter sich aus. Dazu kam, dass ein Weltmeisterschaftsturnier zwischen einem Amerikaner und einem Russen unwillkürlich zur ideologischen Schlacht hochgespielt wurde. Deshalb traf man sich in Reykjavik, auf neutralem Boden also.
Selbsternannter amerikanischer Helden
Bobby Fischer, der hochbegabte junge Mann aus New York, stilisierte sich selbst zum amerikanischen Helden, umgab sich mit rüden Marketingagenten, verlangte Geld und noch mehr Geld, wollte täglich die Bedingungen ändern und ließ bis zum Schluss offen, ob er überhaupt anzutreten gedenke oder nicht.
Dabei wurde nie klar, ob er den Exzentriker nur spielte oder ob er einfach ein verhaltensauffälliger Kerl war, dessen spielerische Genialität jegliches soziale Fehlverhalten entschuldigte. Vielleicht lag die Wurzel für die später bis zum Wahnsinn überzogene Exzentrik in der Kindheit, die der Sohn einer polnisch-jüdischen Mutter und eines deutschen Vaters, hauptsächlich vor dem Schachbrett verbrachte.
Sonderbehandlung für Exzentriker
Die ganze Inszenierung eines Kampfes Ost gegen West täuschte die Öffentlichkeit nur darüber hinweg, dass Fischer den Amerikanern vor allem auf die Nerven ging. Erst wollte er nicht nach Reykjavik reisen, dann fuhr er doch und ließ die Eröffnungspartie platzen. Er regte sich über jede Kleinigkeit auf, bestand auf eine Sonderbehandlung und macht so Boris Spasski fertig, noch ehe er ihm gegenüber saß. Fischer habe sich schlecht benommen, sagt Boris Spasski, das habe ihn beeinflusst. Hätte er gesagt: unter diesen Bedingungen spiele ich nicht, ich gebe auf, wäre Fischer vermutlich nie Weltmeister geworden.
Um das zu verhindern, schalteten sich sogar Präsident Nixon und dessen Sicherheitsberater Kissinger, die mit Vietnam und Watergate ohnehin genug zu tun hatten, ins Geschehen ein. Fischer spielte und gewann die Weltmeisterschaft, als hätte er nie daran gezweifelt. Die Sowjets ließen Spasski spüren, was es bedeutet, einen Krieg zu verlieren. Mit seinem privilegierten Leben war es vorbei, später setzte er sich in den Westen ab.
Analyse beider Weltmeisterschaftspartien
Man muss kein Freund des Schachspiels sein, um das Buch von David Edmonds und John Ediniow spannend zu finden. Obwohl die beiden die Weltmeisterschaftspartien analysieren, handelt ihr Buch doch kaum von technischen Raffinessen, sondern vielmehr von Schach als Metapher für den Kalten Krieg. Und dafür eignet sich das Spiel, das kalte Vernunft ebenso erfordert wie Intuition und die Überrumpelung des Gegners, bestens.
Dazu kommt, dass die Geschichte Bobby Fischers die Geschichte von Genie und Irrsinn um ein weiteres historisches Schicksal bereichert. Wie sagte Vladimir Nabokov: Ein unnormaler Schachspieler ist nichts Unnormales, sondern ganz normal.
Mehr zu Bobby Fischer in ORF.at und oe1.ORF.at
Schach gestern und heute
Bobby Fischers kniffligste Partie
Buch-Tipp
David Edmonds und John Eidinow, "Wie Bobby Fischer den Kalten Krieg gewann", DVA, ISBN 3421056544