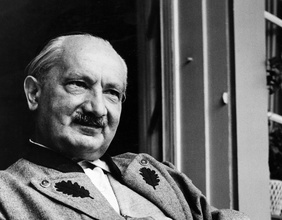Italiens Premierminister kritisch hinterfragt
Über Berlusconi
Unser südliches Nachbarland hat einen Premierminister, der in nicht weniger als 14 Gerichtsverfahren angeklagt war. Wie ist das möglich?, fragen der Schweizer Journalist René Scheu und sein italienischer Kollege Massimo Pillera zehn bekannte Italiener.
8. April 2017, 21:58
Die Mafia, die Korruption, die Geheimloge P2, all das hat die Korrektheit der Politik beeinträchtigt und die Qualität unserer Demokratie beeinträchtigt.
Das meint der Soziologe Nando dalla Chiesa. Und weiter: Angefangen hat das schon Jahrzehnte vor Berlusconi.
Anfang der 90er Jahre kommt es zum großen Knall. Mailänder Richter decken "Tangentopoli" auf, den größten Schmiergeldskandal der italienischen Geschichte. In der Justizoperation "mani pulite" ("saubere Hände") werden mehr als 6000 Unternehmer und Politiker angeklagt, viele verurteilt. Es ist das Ende der so genannten "Ersten Republik", das Ende der Ära wechselnder Koalitionen von Christdemokraten, Sozialisten und mehreren kleineren Partnern.
Eine Partei wie eine Fußballmannschaft
Die Stunde Null der Politik ist die große Stunde des Unternehmers Silvio Berlusconi. Kurz vor den Wahlen 1994, also vor zehn Jahren, stampft er in kürzester Zeit eine Partei aus dem Boden.
Es ist das erste Mal in Italien, dass sich eine Partei nach dem Vorbild eines Unternehmens gebildet hat., beobachtet der Philosoph Gianni Vattimo.
Berlusconis Partei "Forza Italia" heißt und präsentiert sich wie eine Fußballmannschaft. Schon seit Jahren ist Berlusconi ja auch Besitzer von AC Milan. Genau dieser Stilwechsel kommt im politikverdrossenen Italien der 90er Jahre gut an. Der Politiker Silvio Berlusconi positioniert sich als Antipolitiker, analysiert der Politikwissenschaftler Angelo Bolaffi:
"Ich bin nicht wie sie, ich bin anders, ich handle, während sie bloß reden, ich produziere Reichtum, während sie ihn zerstören." So klingt die klassische Rhetorik der Antipolitik. Die dann am besten funktioniert, wenn die traditionelle Politik schlecht läuft.
Vom Staubsauger-Vertreter zum Medien-Zampano
Berlusconi gelingt, womit populistische Bewegungen in anderen Ländern große Schwierigkeiten haben: gleichzeitig Politik zu machen und gegen die Politik zu polemisieren. So pflegt Berlusconi das Image eines tüchtigen Selfmade-man, der sich nicht etwa mit Hilfe, sondern gegen die Politik durchgesetzt hat. Der Student der Rechte verkauft - ja, tatsächlich! Staubsauger; nach dem Studium steigt er höchst erfolgreich in die Baubranche ein, errichtet ganze Satellitenstädte.
In den 80er Jahren investiert er schließlich in die Medienbranche, kauft Fernsehstationen und Verlage. Jedoch: Berlusconi war schon lange eng mit der Politik verbunden, namentlich mit dem inzwischen verstorbenen Sozialistenchef Bettino Craxi. Aber Tatsachen verblassen neben der Ausstrahlungskraft des begnadeten Selbstdarstellers und Schauspielers, das attestiert ihm auch der Theaterautor Dario Fo:
Er benützt die Technik des Verwickelns und Hineinziehens, durch die sich das Theater klassischerweise auszeichnet, um zu verkaufen, und das heißt in seinem Fall meist: um den Leuten Rauch zu verkaufen.
Politik als Schauspiel
Berlusconi hat aus der Politik eine Show gemacht, und das ist schließlich der Bereich, in dem der Fernsehmacher zu Hause ist. Bei fast jeder Gelegenheit wird Berlusconi gefilmt, und die Aufnahmen werden vom Fernsehen bereitwillig ausgestrahlt.
Das Problem dabei ist freilich, dass er die meisten Sender, in denen er auftritt, zugleich besitzt. Er ist nicht nur ein gewiefter Schauspieler in der Mediendemokratie, er ist zugleich ihr Regisseur.
Kapitalismus, auch und gerade mit Hilfe der Politik
Dieser Mediendemokratie gilt eine Hauptsorge der Intellektuellen, die in diesem Buch zu Wort kommen. Sie sorgen sich darüber, wie der (Zitat:) "telekratische Populismus" die geistige Landschaft verändert und was das, sagen wir, heruntergeschraubte intellektuelle Niveau und der reduzierte Informationsgehalt des Fernsehens in den Köpfen der Landsleute bewirkt. Auch die Opposition lässt sich anstecken von der Fixierung auf die Person Berlusconi statt auf Inhalte in der Politik, meint der Psychoanalytiker Antonello Sciacchitano.
Viele Italiener fühlen sich durch Berlusconi vor Europa mit seiner verschärften internationalen Konkurrenz geschützt. Ihre Angst vor dem offenen Wettbewerb deckt sich also in gewisser Weise mit den Bedürfnissen des interventionsfreudigen Premierministers, meint Gianni Vattimo:
Berlusconi ist ein Monopolist. Er gibt vor, den Wettbewerb zu fördern, um ihn in Wirklichkeit abzuschaffen und seinem Unternehmen Vorteile zu verschaffen. Berlusconi praktiziert einen skrupellosen Kapitalismus, auch und gerade mit Hilfe der Politik: Wen ich nicht essen kann, den kaufe ich.
Rechtsstaat in Gefahr
Der Gesprächsband "Über Berlsuconi" versammelt unterschiedliche Positionen: Auf der einen Seite des Spektrums stehen erklärte Linke wie der Literaturnobelpreisträger Dario Fo, auf der anderen der wertkonservative ehemalige Untersuchungsrichter Antonio Di Pietro, der vor Jahren Tangentopoli mit aufdeckte. Sie sehen in Italien weniger die Demokratie in Gefahr als den Rechtsstaat.
So wurde während Berlusconis Amtszeit eine ganze Reihe von Gesetzen eingeführt, um Prozesse gegen ihn zu behindern: die Entkriminalisierung der Bilanzfälschung, eine Verkürzung von Verjährungsfristen, ein neues Immunitätsgesetz, nicht zuletzt ein Gesetz, das es ermöglicht, einen Prozess von einem Gericht an ein anderes zu verlegen, wenn Verdacht auf Voreingenommenheit der Richter besteht.
Mehr Korruption denn je
Zwölf Jahre nach der politischen Revolution infolge der "mani pulite" und zehn Jahre nach Berlusconis Einstieg in die Politik ist Korruption in Italien heute noch verbreiteter und noch akzeptierter als eh und je, so der Grundtenor der Analysen. Der Philosoph Gianni Vattimo:
Wir sind kein Volk von Verbrechern, nicht mehr oder weniger als andere Völker. Aber vielleicht pflegen wir einen manchmal etwas zweifelhaften Umgang mit dem Staat, weil unser Staat lange - und eigentlich bis heute - schwach war.
Auch wenn das Thema des Buchs Berlusconi ist, die Gespräche mit zehn italienischen Intellektuellen und Politikern -übrigens alle Männer -erklären nicht zuletzt so manches über den Hintergrund einer politischen Szene, die im befreundeten Ausland gerne als "halt typisch italienisch" abgetan wird.
Buch-Tipp
René Scheu / Massimo Pillera (Hg.), "Über Berlusconi. Italienische Intellektuelle und Politiker im Gespräch. Angelo Bolaffi, Nando Dalla Chiesa, Gerardo D'Ambrosio, Antonio Di Pietro, Paolo Flores D'Arcais, Dario Fo, Leoluca Orlando, Antonello Sciacchitano, Marco Travaglio, Gianni Vattimo", Verlag Turia & Kant 2003, 2. ergänzte Auflage 2004, ISBN 3851323777