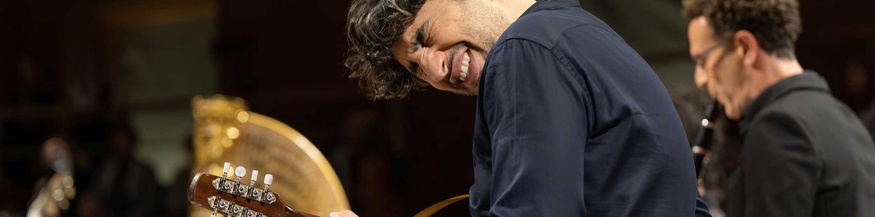Drei verschiedene Wege der körperlichen Anpassung
Leben unter Sauerstoffmangel
Weltweit leben Menschen in drei Regionen auf Hochplateaus: in den Anden, Tibet und Äthiopien. Diese Menschen unterscheiden sich in ihrer Physiologie wesentlich. Hat die Evolution hier drei verschiedene Wege gefunden auf den Sauerstoffmangel zu reagieren?
8. April 2017, 21:58
Wenn vom Leben auf Hochplateaus die Rede ist, dann sind damit Höhenlagen zwischen 3000 und 4500 Metern Seehöhe gemeint. Weltweit sind drei solcher Regionen seit tausenden von Jahren bewohnt: Der Altiplano in den Anden, das tibetische sowie das äthiopische Hochplateau.
Atemschwierigkeiten in großer Höhe
Bei zunehmender Höhe wird das Atmen schwerer. Das liegt am niedrigeren Luftdruck der zu einer geringeren Konzentration von Sauerstoffmolekülen in der Luft führt. Auf 4000 Metern ist die Sauerstoffkonzentration bereits um ein Drittel geringer. Sauerstoff wird von der Lunge ins Blut weitergeleitet, wo er im Hämoglobin transportiert wird. Die Kraftwerke der Zellen, die so genannten Mitochondrien, brauchen Sauerstoff zur Energieproduktion. Das bedeutet: Sauerstoffmangel zieht den ganzen Körper in Mitleidenschaft. All das macht jedoch einem geborenen Hochländer nichts aus.
Mehr Hämoglobin im Blut
Am besten und längsten ist der Organismus der andischen Bevölkerung erforscht. Einer der Mechanismen, der die Hochländer auf dem Altiplano vor der Höhenkrankheit schützt: Eine höhere Konzentration von Sauerstoff transportierenden Hämoglobinmolekülen im Blut. Außerdem haben die Andenbewohner ein 25 Prozent größeres Lungenvolumen als Menschen die auf Seehöhe leben.
"Wenn man auf ein Hochplateau kommt, dann beginnt man sofort schneller zu atmen. Doch die Leute in den Anden haben keine höhere Atmungsfrequenz. Sie atmen so wie wir auf Seehöhe", erklärt die physische Anthropologin Cynthia Beall.
Überraschende Ergebnisse im Tibet
Der Kontakt zu Menschen auf dem tibetischen Hochplateaus war erst ab 1980 möglich. Die Überraschung durch die ersten Untersuchungsergebnisse war groß und ging so weit, dass man anfangs glaubte die Tibeter seien krank. Niemand verstand, warum die Testergebnisse bei dieser Bevölkerung so radikal anders ausfallen konnten als bei den Hochländern der Anden.
Erhöhte Fließgeschwindigkeit des Blutes
"Die Tibeter können auf einer Höhe bis zu 4000 m und sogar noch ein bisschen höher leben, ohne dass sich ihr Hämoglobin erhöht. Es stellte sich also heraus, dass dieses sehr berühmte Anpassungsmuster eine Eigenheit der Leute in den Anden darstellte", erzählt Beall.
Bei den Tibetern scheint die Anpassung an die extreme Höhe durch Veränderungen in der Atmung geschehen zu sein. Denn die Tibeter haben eine deutlich höhere Atemfrequenz und eine erhöhte Fließgeschwindigkeit des Blutes. Ihr Blut ist also ärmer an Hämoglobin, aber zum Ausgleich fließt es schneller.
Keine feststellbaren Veränderungen in Äthiopien
Von allen drei Hochlands-Populationen sind die Äthiopier am wenigsten erforscht. Cynthia Beall führte selber vor zwei Jahren eine Studie mit 236 Äthiopiern im Alter zwischen 14 und 86 Jahren durch. Alle lebten auf 3500 Metern - eine Höhenlage, wo sowohl der Organismus der Menschen der Anden als auch der in Tibet deutliche Veränderungen zeigte.
Auch hier erlebte die Anthropologin eine Überraschung: Bei den äthiopischen Hochlandsbewohnern konnten keine körperliche Anpassungen an die extreme Höhe festgestellt werden.
Schnellere Sauerstoffaufnahme?
Das heißt aber nicht, dass keine Anpassungen entwickelt wurden. Die Anthropologin vermutet, dass der Organismus eine Methode gefunden hat, mehr Sauerstoff aufzunehmen, noch ehe der Körper durch den Sauerstoffmangel in der dünnen Luft Belastung empfindet.
Wie es jedoch kommt, dass drei Bevölkerungsgruppen auf die gleiche Umweltherausforderung auf drei verschiedene Arten reagieren, verwirrt vorläufig noch die Wissenschaftler.