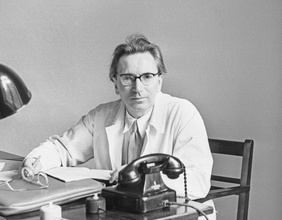Wie man Ideologie mit Fakten widerlegt
Die 10 Irrtümer der Globalisierungsgegner
Ist die Kritik an der Globalisierung nichts weiter als Hysterie? Beruht vieles von dem, was gegen sie vorgebracht wird, auf Ängsten statt auf Tatsachen? Zwei Münchner Journalisten hatten es satt, sich immer wieder die gleichen Klischees anhören zu müssen.
8. April 2017, 21:58
In ihrem Buch versuchen Markus Balser und Michael Bauchmüller zu zeigen, dass vieles von dem, was gegen die Globalisierung vorgebracht wird, auf Einzelfällen, Ausnahmen oder puren Spekulationen beruht und nicht auf statistischen Aussagen.
Belege für und wider
Globalisierung vernichtet unsere Arbeitsplätze und demontiert Verbraucherschutz und Arbeitnehmerrechte, Währungsfond und Weltbank unterdrücken die Schwachen, globale Marken bedrohen die kulturelle Vielfalt und erbitterte Standortwettbewerbe die Umwelt: So lauten einige der Hauptargumente und Befürchtungen der Globalisierungskritiker. Befürchtungen, für die es Belege gibt. Es gibt aber auch Belege für das Gegenteil, sagt Michael Bauchmüller:
"Kinderarbeit z.B. ist ohne Zweifel schrecklich und etwas, das nicht in eine faire Welt gehört. Als wir uns diesem Phänomen genähert haben, haben wir festgestellt, dass Kinderarbeit häufig Kinderarbeit in der Familie ist, im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb. Und dass dieses Klischee vom 12-jährigen Mädchen, das vom Turnschuhproduzenten Nike in Bangladesh ausgebeutet wird, die Ausnahme ist und nicht die Regel."
Starke Staaten für global players
Internationale Konzerne regieren die Welt, sie sind die mächtigsten politischen Kräfte unserer Zeit, erklären Globalisierungsgegner wie Naomi Klein und behaupten, dass Unternehmen wie Wal-Mart, Shell oder General Motors mehr Wirtschaftsmacht besäßen als Länder wie Griechenland oder Südafrika. Falsch, sagen Balser und Bauchmüller. Naomi Klein vergleiche falsche Zahlen, sie stelle dem Bruttoinlandsprodukt nicht die Wertschöpfung, sondern den Umsatz von Unternehmen gegenüber und komme so zu einem völlig schiefen Bild.
Dass die zunehmende Globalisierung mitnichten Macht und Möglichkeiten der Staaten einschränke, das sehe man auch daran, dass in den Industrieländern die Fiskalquote noch nie so hoch war wie heute. Global players, so die Autoren, profitieren nicht von schwachen, sondern von starken Staaten.
Konkurrenz bestimmt den Markt
Mehr als der Staat sei es der Markt, der für die globalen Unternehmen machtbeschränkend wirkt, die Konkurrenz durch andere Wettbewerber und der Druck der Verbraucher. Vor der Hemmungslosigkeit von Branchenriesen schütze eine kritische Öffentlichkeit, die Sünden nicht verzeihe und Marken ruinieren könne.
Wenn ein Unternehmen sich entscheidet, weltweit Handel zu treiben, wird es auch weltweit angreifbar, meinen die Autoren. Die Mittel der Kritik stellt die Globalisierung selbst zur Verfügung: die Kommunikationsnetze, die vor allem regierungs-unabhängige Organisationen zu nutzen wissen.
Mehr statt weniger?
Brauchen wir also in Wahrheit nicht weniger, sondern mehr Globalisierung? Ist das, was schief läuft, nicht den transnationalen Konzernen anzulasten, sondern den Staaten und ihren regulierenden Eingriffen? Brauchen wir nichts weiter als den freien Markt? Dazu Michael Bauchmüller:
"Das Buch hat sicher einige Überspitzungen. Wir glauben auch, dass die Globalisierung sich nicht von selber regeln wird. Es braucht bestimmte Mechanismen, es braucht auch eine Art Weltkartellrecht. Es gibt Bereiche, die in dieser globalen Wirtschaft organisiert und geregelt werden müssen, und diese Bereiche müssen so demokratisch wie möglich geregelt werden."
Fakten vs. Feindbilder
Man wird noch lange über die Globalisierung streiten. Und man wird dabei immer wieder Gefahr laufen, mit Feindbildern zu arbeiten und mit Vorurteilen statt mit Fakten, mit Visionen statt mit Zustandsbeschreibungen. Das Thema ist emotionalisiert. Daran wird wohl auch das Buch von Markus Balser und Michael Bauchmüller wenig ändern.
Immerhin aber gelingt es diesem in seiner informativen, faktenreichen und wohltuend sachlichen Art, einige der gängigsten Thesen der Globalisierungskritiker zu hinterfragen und manchmal auch zu widerlegen. Dass es nicht alle Einwände gegen die Globalisierung zerstreut, dass es auch den spekulativen Trend bemüht, liegt in der Natur der Sache.
Buch-Tipp
Markus Balser, Michael Bauchmüller, "Die 10 Irrtümer der Globalisierungsgegner - wie man Ideologie mit Fakten widerlegt", Eichborn Verlag 2003, ISBN 3821839929