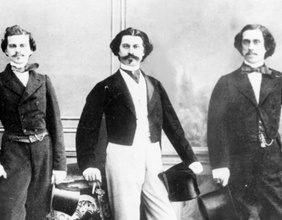Silvester im Volksbrauch
Der letzte Tag im Jahr
Silvester im Volksbrauch: Das ist die Mitte der Raunächte zwischen Christtag und Dreikönig. Die einstige Intention, das Böse abzuwehren, hat sich in ein lautstarkes Begrüßen des neuen Jahres gewandelt. Und das Phänomen Feuerwerk hat manche Musiker inspiriert.
8. April 2017, 21:58
Vierblättriges Kleeblatt, Glücksschweinchen, Rauchfangkehrer, Hufeisen, Schwammerl und Bleifiguren - das sind so die gängigen Paraphernalien des Jahreswechsels, der da Silvester genannt wird. Allesamt heidnische oder ketzerische, jedenfalls abergläubische Gebräuche, denen einmal zum Ausgleich die christlichen Wurzeln dieses Tages gegenübergestellt seien.
Der Heilige Silvester: Er war Papst. Seine Amtszeit (314-335) fällt in eine entscheidende Epoche des Christentums, das sich in dieser Zeit unter dem römischen Kaiser Konstantin von einer verfolgten Sekte zu einer staatlich tolerierten und geförderten Religion entwickeln konnte. Der Kaiser hatte in seinem Mailänder "Toleranzedikt" von 313 die Religionsfreiheit eingeführt. In Silvesters Ära fiel auch das Konzil von Nicäa: Es brachte das bis heute gültige Glaubensbekenntnis ("Credo").
Wenig über Herkunft bekannt
Über Silvesters Herkunft ist wenig bekannt. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat er sich während der grausamen Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian als Bischof bewährt und großes Ansehen erworben. Papst Silvester starb am 31. Dezember 335. Er wird als Patron für ein gutes neues Jahr angerufen. Bauern bitten ihn auch um Schutz für ihre Tiere.
Dieser Beziehung liegt eine Legende zugrunde, auf die sich Wolfram von Eschenbach im zweiten Buch seines Epos "Parzival" bezieht, wenn er in der Szene auf der Gralsburg nach Parzivals "Mitleidsfrage" an Anfortas die "Silvester-Referenz" einfügt:
Gott, der auf Bitte des Hl. Silvester einen Stier vom Tod erweckte und lebendig davon traben ließ, der dem Lazarus gebot, sich wieder aufzurichten, bewirkte nun auch, dass Anfortas genas und seine volle Gesundheit zurückerlangte.
Religions-Disput
Der in der mittelalterlichen "Legenda Aurea" überlieferten Sage zufolge gab es einen Religions-Disput zwischen Papst Silvester und zwölf jüdischen Gegnern vor Kaiser Konstantin und dessen Mutter Helena: Diese ließen einen Stier durch den zugeflüsterten Namen ihres Gottes tot umfallen; Silvester erweckte ihn im Namen Christi wieder. Die Übertragung der Macht Christi über Leben und Tod auf den Papst wurde so für die Nachwelt plausibel gemacht.
Zweiter Papst namens Silvester
Es gab aber noch einen zweiten prominenten Papst namens Silvester. Gerbert von Aurillac war sein bürgerlicher Name, Aurillac bezieht sich offenbar auf seinen Geburtsort in der südlichen Auvergne. Um 960 geboren, wurde er Priester und genoss in Spanien eine glänzende Ausbildung, die er durch eigene theologische und besonders astronomische Studien ergänzte, bis er zu den wichtigsten Männern Europas zählte. So brachte er das Astrolabium nach Deutschland und rechnete als erster Mitteleuropäer mit arabischen Zahlen. Der junge Kaiser Otto III. machte ihn zu seinem Lehrer, Ratgeber und Vertrauten und setzte ihn dann als Erzbischof von Ravenna ein.
Papst-Karriere als Höhepunkt
Im Jahre 999 erreichte er den Höhepunkt seiner Karriere: Mit dem Namen Silvester II. wurde er Papst. Dies war ein heikler Zeitpunkt, denn die Tradition mutmaßte, dass um Mitternacht des 31. Dezember 999 die Welt untergehen würde. In der christlichen Welt brach eine Massenhysterie aus. Aber als sich die Welt am ersten Januar des Jahres 1000 noch immer drehte, beruhigte sich das Volk wieder. Und Papst Silvester zog sich aus der Affäre, indem er behauptete, nur seine Gebete hätten den drohenden Weltuntergang verhindert.
Silvester im Volksbrauch
Silvester im Volksbrauch - das ist die Mitte der sogenannten Raunächte in der Zeit zwischen Christtag und Dreikönig. Ausgehend vom germanischen Volksglauben, dass in dieser Nacht der Wintersonnenwende die jenseitigen Mächte besonders stark sind, dass Wotan mit seinem wilden Heer mit Sturmesheulen und brausendem Lärm durch die Wälder und Lüfte saust und das Böse nur durch großen Lärm abzuhalten sei, entstand der Brauch des Neujahrsschießens.
Das Böse abzuwehren als ursprüngliche Intention unserer heidnischen Vorfahren hat sich in ein freudiges und lautstarkes Begrüßen des neuen Jahres gewandelt. Das Schießen mit Böllern und Gewehren kam bald nach der Verbreitung des Schwarzpulvers auf.
Feuerwerk seit dem 18. Jahrhundert
Das aus China importierte Feuerwerk tat dann seit dem 18. Jahrhundert ein Übriges. Der freudige Lärm kombiniert mit optischem Reiz - das ist bis heute eine Mischung von Atavismen und Sinnesfreude, die Fragen nach dem eigentlichen Sinn in den Hintergrund drängen. Und das Phänomen Feuerwerk hat auch eine Reihe von Musikern zu prunkvollen oder illustrativen Begleitmusiken inspiriert: Von Georg Friedrich Händels "Music for the Royal Fireworks" über Claude Debussys "Feux d'artifice" bis zu Igor Strawinskys "Feuerwerk"-Fantasie.