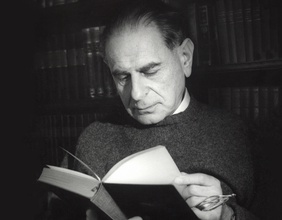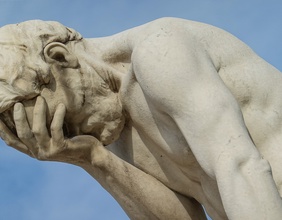Die zwölf Freunde der EU
Europäische Nachbarschaftspolitik
Die Erweiterung der EU war in der Vergangenheit eines der erfolgreichsten Instrumente der europäischen Außenpolitik. 2003 hat die EU die Wider-Europe-Politik beschlossen, die auch die Länder an die Union heranführen soll, die nicht Mitglieder werden können.
8. April 2017, 21:58
Die Erweiterung der europäischen Union war in der Vergangenheit eines der erfolgreichsten Instrumente der europäischen Außenpolitik: Die Länder im Osten und Süden der alten Europäischen Gemeinschaft wurden so an die wirtschaftlichen, menschenrechtlichen und rechtlichen Standards der Union herangeführt, um schließlich Mitglieder zu werden.
2003 hat die EU die Wider-Europe-Politik beschlossen, die auch die Länder an die EU heranführen sollte, die nicht Mitglieder werden können oder wollen - Kommissionspräsident Prodi sprach damals von einem "Ring der Freunde" rund um die EU.
Krisenherd Libanon
Das Land ist nach den Kämpfen in palästinensischen Flüchtlingscamps und mehreren Bombenanschlägen erneut in die Krise gerutscht, erklärt der Leiter der Delegation der EU-Kommission in Beirut, der Franzose Patrick Laurent. Angst vor einem neuen Bürgerkrieg liegt in der Luft.
Das Anliegen der Europäischen Union im Libanon ist daher, im Wesentlichen dem Libanon bei der Entwicklung zu einem echten Staat zu helfen, wie Laurent betont. "Der Libanon hat einige Elemente eines Staates, der Libanon hat außerdem einige Elemente einer Demokratie, anders als die anderen Länder im Nahen Osten. Was die Europäische Union hier erreichen kann wird davon abhängen ob es dem libanesischen politischen System gelingt, stabiler zu sein", sagt Laurent.
Zwölf Freunde
Der Libanon ist eines von zwölf Ländern, das mit der EU Verträge im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik abgeschlossen hat - neben den Anrainerstaaten des Mittelmeeres sind das etwa die drei Kaukasus-Republiken Georgien, Armenien und Aserbaidschan sowie die Ukraine und Moldawien.
Die Europäische Nachbarschaftspolitik will diese Länder näher an die EU heranführen - allerdings ohne das Ziel einer späteren Mitgliedschaft - Länder wie die Türkei fallen daher nicht in den Bereich der Nachbarschaftspolitik, sondern der Erweiterungspolitik.
Beispiel: Libanesische Justiz
Der Aktionsplan für den Libanon besteht aus einem recht umfassenden Programm zur Erleichterung der wirtschaftlichen und politischen Integration.
Ein Beispiel, wie die Nachbarschaftspolitik funktioniert ist die Reform der libanesischen Justiz. Im Aktionsplan der EU sind vier Punkte geplant: Ein umfassendes Schulungsprogramm für die Sekretäre und das Büropersonal, Unterstützung bei der Umstellung der Justiz auf ein einheitliches EDV-System, Erleichterungen beim Zugang zu Rechts- und Gesetzesmaterialien der EU und die Bereitstellung eines neuen Arbeitsraumes mit Übersetzerkabinen, damit ausländische Experten besser mit den Richtern zusammenarbeiten können. Das sei nicht nur für die Menschenrechtssituation im Land wichtig, sondern stärke durch die damit verbundene Rechtssicherheit auch die Wirtschaft, erklärt die Projektleiterin Sibylle Bikar.
Weitere Projekte
Weil innerhalb der EU aber alles nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick erscheint, gibt es neben der Europäischen Nachbarschaftspolitik noch andere EU-Programme, die im Libanon aktiv sind. Eines davon ist die Katastrophen-Hilfe ECHO.
ECHO ist nach dem Krieg im vergangenen Sommer ins Land gekommen. Sollte es nicht zu einer neuen Eskalation und damit zu neuen Zerstörungen kommen, wird sich ECHO gegen des Endes des Jahres aus dem Libanon zurückziehen.
Eines der Projekte von ECHO ist durch die aktuelle Krise bereits wieder in Mitleidenschaft gezogen worden. Im palästinensischen Flüchtlingslager Nahr-El Bared, in dem zuletzt schwere Kämpfe ausgebrochen sind, hat sind die von der EU errichteten Wasserversorgungsanlagen bereits wieder zerstört.
Kritik von Expertenseite
Insgesamt investiert die Europäische Union pro Jahr 45 Millionen Euro im Rahmen der Nachbarschaftspolitik in den Libanon. Die beiden größten Brocken - jeweils knapp 45 Prozent der Gesamtsumme, fließen in Unterstützung beim Wiederaufbau und in soziale und wirtschaftliche Reformen. Weitere zwölf Prozent gehen in die Unterstützung des politischen Reformprozesses.
Das sei zu wenig, damit die EU wirklich Einfluss im Libanon nehmen können kritisiert Antonio Missrolli vom European Policy Center, einem Think-Tank in Brüssel. "Die Normen und Regeln bei der Vergabe von EU-Geldern sind auch im Ausland sehr streng. Und manchmal sind diese Regeln in der Region einfach nicht anwendbar", sagt Missrolli.
Der Iran, Syrien und andere arabische Staaten würden diese Lücke füllen - diese Hilfe sei aber mit politischen, ideologischen und religiösen Forderungen verknüpft. Die EU verspiele hier viele bestehende Möglichkeiten.
Missriolli hat ein generelles Problem mit der Nachbarschaftspolitik: Zwischen den Mittelmeerländern, dem Kaukasus und Osteuropa gebe es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten - statt eines einheitlichen Programms für alle Nachbarn sollte die EU ihre Politik genauer an die Situation in den einzelnen Regionen anpassen.
Die libanesische Seite ist mit der Unterstützung aus Europa auf jeden Fall zufrieden, erklärt Marwan Hamadi, der als Handelsminister den Aktionsplan mit der EU verhandelt hat. Trotz der immer engeren Verbindungen stehe eine Mitgliedschaft bei der Europäischen Union nicht am Programm der libanesischen Regierung: "Ich weiß nicht, ob die EU im Raum des östlichen Mittelmeeres Erweiterungen plant. Wenn ja, wären wir gerne bei den Europäern. Aber wir werden uns der Union sicher nicht aufdrängen."
Mehr zu den aktuellen Entwicklungen im Libanon in ORF.at
Hör-Tipp
Europa-Journal, jeden Freitag, 18:20 Uhr