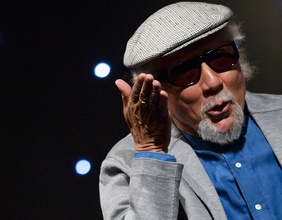Bildungsvisionen von den 1960er Jahren bis heute
Der Kampf um die "richtige" Bildung
"Erziehung zur Mündigkeit" und eine nachhaltige Demokratisierung der Gesellschaft - das waren die großen Bildungsvisionen der 1960er Jahre. Haben diese Visionen in der Gegenwart an Strahlkraft eingebüßt? Eine Zeitreise durch 40 Jahre Bildungsdebatte.
8. April 2017, 21:58
Autoritär, hierarchisch und starr - so erlebte Alfred Schirlbauer, heute Professor für Pädagogik an der Universität Wien, die Schule der 1960er Jahre. "Ich erinnere mich an einen Lateinlehrer - einen ehemaligen Wehrmachtsoffizier - der sich in der ersten Lateinstunde gleich einmal damit vorgestellt hat, dass er nicht unser Lehrer, sondern unser Zenturio sei. Wir hätten stramm zu stehen und unser Benehmen im Unterricht hätte genau so exakt zu sein wie die lateinische Grammatik."
Erfahrungen wie diese prägten die Studierendengeneration, die Ende der 1960er Jahre zum Kampf gegen autoritäre Bildungsvermittler und die verkrusteten Strukturen des Bildungssystems aufrief. "Unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren" lautete der zentrale Schlachtruf. Schule und Universität sollten demokratischer, die Lehrinhalte gesellschaftskritischer, die Unterrichtsformen selbstbestimmter werden.
Die Hoffnungen, die die 68er-Bewegung in ein reformiertes Bildungssystem setzte, waren groß: Bildung, verstanden als "Erziehung zur Mündigkeit", wie es der Soziologe und Philosoph Theodor W. Adorno formuliert hatte, sollte zum Mittel werden, über das sich eine offenere, demokratischere und tolerantere Gesellschaft herstellen lässt.
Bildung im Zeichen des Wettbewerbs
Die emanzipatorischen Visionen der 68er-Bewegung waren allerdings nicht die einzigen, die die damalige Bildungsdebatte nachhaltig beeinflussten. "Der Bildungsbegriff und das Thema in den späten 1960ern wurde sicherlich dominiert von der Situation des Kalten Krieges", meint Agnieszka Dzierzbicka, Assistentin am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien:
"Der so genannte Sputnik-Schock hat ja den Westen ziemlich durcheinander gerüttelt in dem Sinne, wie ein ganzer Block, der vermeintlich rückschrittlich ist, den Westen schlagen und den ersten Satelliten ins All schicken kann. Das hat enorme Auswirkungen gehabt auf die Reflexion 'Was ist Bildung?' im Westen. Was soll der 'neue Mensch' des Westens können, was kann er? Und wie ist es möglich, dass er diesen Kampf verloren hat? Hier wurde sehr schnell mit Investitionen in die Bildung reagiert. Und die stand auch schon in den 60er Jahren nicht nur im Zeichen der hehren Idee des Friedens, sondern sehr wohl auch im Zeichen des Wettbewerbs auf einer globalen Ebene."
Errungenschaften der 1970er Jahre wie der freie Hochschulzugang lassen sich für Dzierzbicka demnach nicht nur als demokratiepolitisches, sondern vor allem auch als arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitisches Signal lesen: Mehr Akademiker und Akademikerinnen sollten die Wettbewerbsfähigkeit des Landes garantieren.
Bildung versus Ausbildung?
Vor dem Hintergrund der zunehmend angespannten Arbeitsmärkte in den 1980er Jahren begannen die emanzipatorischen Bildungskonzepte der 1960er immer mehr zu verblassen: Bildung wurde und wird verstärkt in Richtung Ausbildung und Jobqualifikationen gedacht. Ein Trend, der sich nicht nur in der Gründung der ersten Fachhochschulen im Jahr 1993, sondern auch in den Angeboten im Feld der Erwachsenenbildung spiegele, meint Elke Gruber, Professorin für Erwachsenen- und Berufsbildung an der Universität Klagenfurt. "Der Fokus ist nicht mehr 'zuerst Demokratisierung und dann jemanden für den Arbeitsmarkt möglichst brauchbar zu machen', sondern es funktioniert umgekehrt. Zuerst kommt mittlerweile die berühmte 'employability', erst dann geht es um die Herstellung einer demokratischen Gesellschaft."
Man werde sich in einigen Jahrzehnten vielleicht noch wundern, meint Alfred Schirlbauer, wie sehr sich die Bildungsidee innerhalb von nur 30 Jahren beinahe in ihr Gegenteil verkehrt habe: "Also von der Idee der Emanzipation des Menschen aus unterdrückerischen Verhältnissen heraus zu einer Bildungsidee, in der sich der Mensch gewissermaßen selber präpariert und selber fit macht für Verhältnisse, die durchaus als ausbeuterisch zu bezeichnen sind. Man braucht ja nur an den Ausdruck der McJobs zu denken, an die prekären Arbeitsverhältnisse: Hier ist ja von Emanzipation und Selbstverwirklichung überhaupt keine Rede mehr."
Mehr zum Sputnik-Schock in oe1.ORF.at und science.ORF.at
Hör-Tipp
Radiokolleg, Montag, 1. Oktober, bis Donnerstag, 4. Oktober 2007, 9:05 Uhr
Mehr dazu in oe1.ORF.at
Buch-Tipps
Theodor W. Adorno, "Erziehung zur Mündigkeit", Suhrkamp Verlag, ISBN 9783518365113
Agnieszka Dzierzbicka, Alfred Schirlbauer (Hg.), "Pädagogisches Glossar der Gegenwart. Von Autonomie bis Wissensmanagement", Löcker Verlag, ISBN 3854094388
Paulus Ebner, Karl Vocelka, "Die zahme Revolution. '68 und was davon blieb", Ueberreuter Verlag, ISBN 9783800036790
Roman Gepp, Wolfgang Müller-Funk, Eva Pfisterer (Hg.), "Bildung zwischen Luxus und Notwendigkeit", Lit Verlag (Schriftenreihe der Waldviertler Akademie 1)
Elke Gruber, "Bildung zur Brauchbarkeit? Berufliche Bildung zwischen Anpassung und Emanzipation. Eine sozialhistorische Studie", Profil Verlag, ISBN 3890194141
Konrad Paul Liessmann "Theorie der Unbildung", Zsolnay Verlag, ISBN 9783552053823