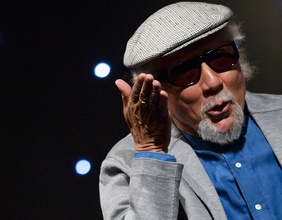Ein Staatenverbund ohne Musikpolitik
Wie klingt Europa?
Das Europa meiner Gegenwart hat keinen Klang, es gibt de facto keine Musikpolitik. Nicht einmal auf eine Europa-Hymne konnte man sich einigen. Und doch, jetzt schon: Es gibt europäische Musikprojekte, die klangvoll und prominent sind.
8. April 2017, 21:58
Keine Einigung über Europa-Hymne
Das Europa meiner Kindheit klang anders, es überhörte die halbe Welt, es hatte genug mit Mozart und Beethoven und ein wenig Strawinsky oder Satie. Modern waren die Kücheneinrichtungen, das musste die Musik nicht sein. Die Musik stützte den Staat, Mozart wurde 1955 fromm und katholisch, weil das damalige Österreich ihn fromm und katholisch wollte. Europa klang so, wie man es als Bollwerk gegen den verschlossenen Osten hören wollte, gegen den nahen Osten, der in vielen führenden Köpfen fern sein sollte.
Das Europa meiner Gegenwart hat keinen Klang, es gibt - de facto - keine Musikpolitik; das European Music Office (EMO) ist eine NGO, deren Pläne der Verwirklichung harren. Nicht einmal auf die Europa-Hymne nach Schillers "Ode an die Freude" in Tönen Beethovens konnte man sich im Verfassungsvertrag beziehungsweise Reformvertrag einigen. Auch gut. Wäre ja doch sehr rückwärtsgewandt gewesen, der Song von den Brüdern unterm Sternenhimmel. Da sind sich auch meine Interviewpartner Emil Brix - zuständig für die Auslandskultur in Österreich - und Peter Rantasa, Direktor des mica, des "music information center austria", einig.
Prominente europäische Musikprojekte
Und doch, jetzt schon: Es gibt europäische Musikprojekte, die klangvoll und prominent sind. Das berühmte European Chamber Orchestra hat eine kleine Schwester, das European Youth Chamber Orchestra, das in Graz Arbeitswochen und Auftritte absolviert.
Leiter ist der Philharmoniker René Staar, die Idee des damaligen Rektors Otto Kolleritsch geht auf: Die Kooperation reichte von Anfang an über das Gebiet der EU hinaus, man spielte anfangs gemeinsam mit den Studierenden aus St. Petersburg, in diesem Jahr musizieren Jugendliche aus Cluj/Rumänien, Graz und aus Jerusalem miteinander. Man gibt Bach und Mozart - die Gegenwart muss wieder ein wenig warten.
Ausbildung im Digital-Audio-Bereich
Es gibt schwierig zu ergatternde, aber gut dotierte Unterstützung für Kooperationsprojekte. Das mica koordiniert beispielsweise mit EU-Geldern eine zeitgemäße Ausbildung im Digital-Audio-Bereich: DMET (Digital Music Education and Training) entwickelt ein Curriculum, wird Workshops anbieten und soll in eine Schule münden.
Die Kulturhauptstädte entwickeln eine Produktionskraft, ein europäisches Opernzentrum - die einzige von der EU gegründete Kulturinstitution - wird 2008 in Liverpool ein Zentrum der Aktivitäten sein. Vieles geht leichter - sogar der Bau des Linzer Opernhauses - mit dem Titel EU-Kulturhauptstadt, was mehr an der PR als am Geld liegt.
Keine Kultur-Förderstipendien
Um zeitaufwändige und langwierige Einreichungsprozeduren überhaupt bewältigen zu können, braucht es zu den bestehenden darüber hinausgehende Hilfen. Förderstipendien, die bereits die Einreichung finanzieren, bietet zwar die Wissenschaft in der EU, nicht aber die Kultur. Auch an dieser Schallmauer verklingt viel.
Arien der Bürokratie sind die Papiere: Gestützt auf/in Kenntnis der Entschließung/unter Hinweis auf seine Entschließung/in Kenntnis des ersten Berichts/in der Erwähnung/hält es für wünschenswert/fordert/wünscht/ist der Auffassung/unterstreicht/drängt darauf/ersucht/ermutigt/schlägt der Kommission vor/begrüßt/beauftragt...
Abgesehen davon, dass diese EU-Rezitative der Vertonung harren, bin ich der Meinung, dass sämtliche EU-Festakte, Konzerte für Europa, Europatage und Präsidentschaftsfeiern mit zeitgenössischer Musik begangen werden sollen. Bach ist passé. Unsere Politiker haben ja auch keine Rembrandts in ihren Büros hängen, sondern Staudachers oder Krystufeks.
Hör-Tipp
Apropos Musik. Das Magazin, Sonntag, 14. Oktober 2007, 15:05 Uhr
Mehr dazu in oe1.ORF.at
Links
European Music Office
mica