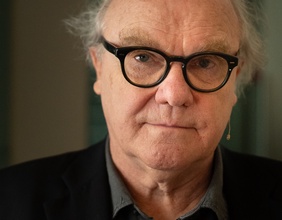Ein Verleger ärgert sich
Der ungarische Brahms
Brahms' "Ungarische Tänze" gehen auf die Bekanntschaft mit dem Geiger Eduard Reményi, den Brahms auf einer Tournee begleitet hatte, zurück. Brahms hat sich nicht mit fremden Federn geschmückt, mit Bedacht hat er dem Werk keine Opuszahl gegeben.
8. April 2017, 21:58
Drei Mal ungarischer Tanz Nummer fünf
Am 15. Oktober 1940 fand in New York die Uraufführung von Charlie Chaplins erstem Tonfilm "The great dictator" statt. Unvergesslich die Szene, in der er als jüdischer Friseur einen Kunden rasiert - zu berühmten Klängen aus dem Radio, Brahms' "Ungarischem Tanz" Nummer fünf.
Brahms "Ungarische Tänze" gehen zurück auf die Bekanntschaft mit dem ungarischen Geiger Eduard Reményi, den Brahms auf einer Tournee begleitet hatte.
Verpasste Verleger-Chance
"Vier Palais hätt’ ich heut" - so ärgerte sich der Budapester Musikalienhändler und Verleger, dem Johannes Brahms 1867 als erstem eine Anzahl ungarischer Tänze angeboten hatte, die der nicht übernehmen hatte wollen, Jahre später. Selbst schuld, kein Mitleid, kann man da nur sagen.
Kollege Simrock in Leipzig war besser dran, denn die "Ungarischen Tänze" erwiesen sich in ihrer Fassung für Klavier zu vier Händen als dermaßen erfolgreich, dass sie bald in unzähligen Bearbeitungen auf den Markt kamen.
Verletzter Nationalstolz
Erfolg macht neidisch. Vor allem von ungarischer Seite wurde Brahms, der Nicht-Magyar, verschiedentlich attackiert und des Plagiats beschuldigt - verletzter Stolz einer Nation, die sich gerade in der Zeit um 1867 gegenüber Wien politisch zu behaupten begann, mag eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben; es hieß, Brahms habe bereits existierende Melodien für seine Tänze benutzt; unter anderem behauptete Eduard Reményi, der Komponist von einigen dieser Weisen zu sein.
Ede Reményi war ein ausgezeichneter Geiger, der seine Konzerte mit improvisierten Zigeunerfantasien beschloss. Brahms - selbst kein Ethnologe - war überzeugt, es handle sich bei den von seinem Duopartner verwendeten Melodien um Volksmusik, speicherte sie im Kopf ab und veränderte sie mit der Zeit. Rein sachlich ist der Vorwurf des Plagiats unbegründet.
Gesetzt von Johannes Brahms
Brahms hat sich hier nicht mit fremden Federn geschmückt, ganz mit Bedacht hat er den "Ungarischen Tänzen" (vier Hefte, entstanden zwischen 1852 bis 1869) keine Opuszahl gegeben - sie also nicht als "Werk" gekennzeichnet und für den Titel ausdrücklich die Formulierung "gesetzt von Johannes Brahms", gewünscht, zum anderen wurden in Ungarn selbst solche Melodien als musikalisches Gemeingut angesehen, jede Banda, jeder Bearbeiter konnte sich dessen bedienen.
So sie ihm bekannt waren, hat Brahms die Quellen zu den Tänzen auch genannt. Dem Verleger Simrock kündigte er, 1868, bei der Übersendung der Stichvorlage die "Ungarischen Tänze" wie folgt an: "Es sind übrigens echte Pussta- und Zigeunerkinder. Also nicht von mir gezeugt, sondern nur mit Milch und Brot großgezogen."
Nah an den Quellen
Der Dirigent Iván Fischer versucht in seiner Aufnahme mit dem Budapest Festival Orchestra aus dem Jahr 1999 eine erfrischend neue Sicht, mit Orchesterbearbeitungen, die die Musik näher an ihren Zigeunerursprung rückt. Fischers Überlegung dabei:
Noch immer spielen Zigeunermusiker in ungarischen Restaurants, und so können wir Zeuge einer ungebrochenen Tradition werden: gibt es doch Zigeunerdynastien, in denen der Vater, der Großvater, ja sogar der Urgroßvater bereits Violinisten waren - und alle haben die Ungarischen Tänze von Brahms gespielt oder spielen sie noch. Und wenn der Großvater vielleicht noch die ursprüngliche Weise gespielt hat, so spielt der Enkel das gleiche Stück heute in der auf Brahms zurückgehenden Fassung. Cimbalom-Virtuosen haben dabei stets eine Continuo-Begleitung nach Zigeunerart beigesteuert, die sich selbst über die letzten beiden Jahrhunderte hinweg nur wenig geändert hat. Und wenn heutige Zigeunerkapellen im Vergleich zu dem, was Brahms niedergeschrieben hat oder was sie von ihren Vorfahren gehört haben, diese Tänze auch mit anderen Passagen, Ornamenten und Tempi spielen, so dürfte der Stil doch noch sehr ähnlich sein.
Saftig bis sportlich
Hören Sie unserem Audio drei Versionen von Brahms' "Ungarischem Tanz" Nummer fünf: mit dem Wiener Geigen Quartett (herzhaft, saftig, mit viel Bogenhaaren auf den Saiten, schlank instrumentiert), dem Salonorchester Cölln (sportlicher, glatter, kühler, zackiger) und Sanodr Lakatos und seinem Orchester (Brahms, rückgeführt auf die Spielmanier einer ungarischen Roma-Banda).
Hör-Tipp
Ausgewählt, Mittwoch, 17. Oktober 2007, 10:05 Uhr
Mehr dazu in oe1.ORF.at
CD-Tipp
Johannes Brahms, "Ungarische Tänze", Budapest Festival Orchestra, Iván Fischer, Philips 462 589-2 LC 00305
Link
IMSLP - Die Noten der "Ungarischen Tänze" als PDF
Übersicht
- Interpretationen