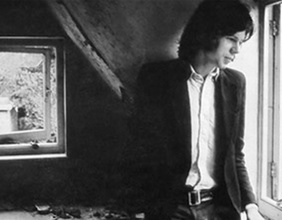Das verzerrte Bild des Star-Tenors
Das Phänomen di Stefano
Der jüngst verstorbene Tenor Giuseppe di Stefano hat nicht nur in Bezug auf seine künstlerischen Qualitäten für Diskussionen gesorgt. Geschichten und Gerüchte machten Schlagzeilen. Was ist wahr? Ein Intimus des Tenors gibt Auskunft.
8. April 2017, 21:58
Als am Montag, den 3. März 2008 die Nachricht vom Ableben des italienischen Startenors Giuseppe di Stefano durch die Medien ging, wurden einem neben allen Daten und Fakten dieser Ausnahmekarriere plötzlich auch all jene Geschichten und Gerüchte in Erinnerung gerufen, die jahrzehntelang für Schlagzeilen gesorgt hatten, auch jenseits der Kulturseiten.
Dabei hat di Stefano allein in Bezug auf seine künstlerischen Qualitäten schon für genügend Auseinandersetzungen gesorgt. Jede Menge von Experten (auch selbsternannte) wurden da auf den Plan gerufen, von Jürgen Kesting bis Karl Löbl, um bei zwei Prominenten dieser Zunft aus dem deutschen Sprachraum zu bleiben, deren Beurteilungen von di Stefano meist ziemlich gegensätzlich ausgefallen sind.
Verzerrtes Bild in der Öffentlichkeit
Besonders ernsthaft auseinander gesetzt mit dem Phänomen di Stefano hat sich Thomas Semrau in seiner 2002 im Residenz-Verlag erschienen Biographie "Alles oder nichts", aber - und das in verschiedensten Publikationen - immer wieder auch der ebenfalls in Österreich lebende Sammler, Autor und persönliche di Stefano-Freund Peter Hutchinson. Aus Anlass des Todes von Giuseppe di Stefano hat Hutchinson in einem E-Mail auf verschiedene immer wieder verbreitete Gemeinplätze hingewiesen, die das Bild di Stefanos oft verzerren:
Vielfach habe ich jetzt wieder gelesen, er sei leichtfertig, unprofessionell, labil und so weiter gewesen. Ich finde, das sieht man ganz falsch. Ich berufe mich auf die bekannte Aussage von Josef Krips, "Ohne Liebe kann man keine Musik machen"; Ähnliches kann man bei di Stefano sagen, nur müsste man statt "Liebe" eher "Glücksgefühl" oder "Lebensfreude" oder so etwas sagen. Wie Gigli wollte er für die Menschen singen, um seine Liebe zum Leben mit uns zu teilen; und dazu brauchte er den Spaß im Spielcasino und den Genuss an Frauen. Die Frauen waren willig und das Geld hatte er selber verdient und somit ist unsere Meinung darüber nicht von Bedeutung. Und unbedingt zu betonen dabei ist, dass er ein ungemein seriöser Künstler war, der seine Rollen sehr eingehend studierte.
Mehrere Bekannte haben mir bestätigt, dass sie ihn oft genug angetroffen haben, als er sich die Partitur (nein, nicht den Klavierauszug!) eines Werkes anschaute, das er schon seit vielen Jahren "drauf" hatte. Er wusste sehr wohl, was professionelles Verhalten war. Dass er ab Ende der 50er an chronischen Indispositionen litt, weil er nicht gewusst hatte, dass er gegen Nylon allergisch war (woher hätte es wissen sollen, Nylon kam erst in den 50ern nach Italien) und gerade in ein neues Appartement in San Siro eingezogen war, wo Auslegeware aus Nylon in jedem Raum war, ist Faktum. Ein Intimus sagte mir, er hat monatelang versucht, in der Badewanne zu schlafen, weil im Badezimmer kein Nylon war. Jedenfalls falsch ist die Vermutung, er habe sich stimmlos gesoffen. Und selbstverständlich ist auch unwahr, dass er soviel verzockt habe, dass er als alter Mann mittellos war. Geld war für ihn nie ein Problem. Das war die Freiheit, die er brauchte, um loslegen zu können auf der Bühne aus Überschwang an Glück.
Jaja, ich weiß, Bing hat ihn gefeuert, weil er nicht zum Anfang der Proben der Bohème in der Stadt war. Aber Bings Prinzip war, alle müssen vom Anfang an da sein, ob sie drankommen oder nicht. Sagen Sie das heute etwa Domingo, und er lacht ihnen ins Gesicht. Das Haus hat längst den Probeplan nach der Verfügbarkeit des Stars zu richten und nicht umgekehrt. Das ist Praxis. Für Bing war es eine Frage des Prinzips und nicht wirklich sachlich begründet...
Starrsinn und Schalk im Nacken
Wie immer man die Dinge auch betrachtet, eine gewisse Unberechenbarkeit verbunden mit echt sizilianischem Temperament ist Giuseppe di Stefano wohl ebenso nicht abzusprechen wie seine Starrsinnigkeit, die auch aus vielen Interviews aus seinen letzten Jahren spricht.
Doch dürfte ihm bei solchen Gelegenheiten oft der Schalk im Nacken gesessen sein, wenn er etwa in Bezug auf seinen Zigarren-Konsum meinte: "Ja, ich rauche ununterbrochen. Schon immer. Caruso rauchte täglich mindestens ein Päckchen ägyptischer Zigaretten und er war der vollkommenste Sänger aller Zeiten. Doch Zigaretten trocknen die Kehle aus. Meine Zigarren aber halten meine Kehle feucht, sie fördern den Speichelfluss. Übrigens, kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen einem armen und einen reichen Tenor? Der arme Tenor muss seinen Rolls-Royce selbst waschen!"
Mehr zum Tod Giuseppe di Stefanos in oe1.ORF.at
Hör-Tipp
Apropos Oper, Dienstag, 11. März 2008, 15:06 Uhr