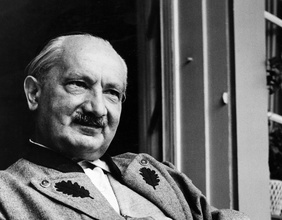Streben nach Glück im Wandel der Zeit
Fortuna und Felix
So viel vorweg: Glücklich sein kann man lernen, aber man kann es sich nicht erkaufen. Die Suche nach dem Glück ist so alt wie die Menschheit, die Ansprüche und Voraussetzungen dafür haben sich allerdings gewandelt.
8. April 2017, 21:58
In der Antike haben Fortuna und Felicitas über das Glück bestimmt. Heute suchen wir unser Glück mit Hilfe zahlreicher Ratgeber: Der Markt der Glücksversprechen boomt, und auch die Wissenschaft hat sich des Themas angenommen. Aber ist und war es tatsächlich so einfach?
Wie definiert sich Glück?
Fest steht, Glück ist nicht fassbar. Ebenso schwer ist es, eine allgemeingültige Definition dafür zu finden. Das Streben nach Glück ist so alt wie die Menschheit selbst. Nur das Recht auf Streben nach Glück ist ein relativ junges Phänomen: Es wurde erstmals in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 formuliert, als pursuit of happiness.
Doch damals verstand man unter Glück etwas anderes als heute, denn die Vorstellungen vom Glück unterliegen einem stetigen Wandel. Sie sind an sich ändernde gesellschaftliche Werte und Normen gebunden. Welche Faktoren das subjektive Wohlbefinden - also das Glück - heute beeinflussen, versuchte eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung herauszufinden.
Sie kam zu dem Schluss, dass Partnerschaft und Kinder einen erheblich größeren Einfluss auf das Glück hätten als Einkommen. Der positive Effekt eines Kindes auf das subjektive Wohlbefinden etwa sei nur durch ein 180fach höheres Einkommen auszugleichen.
Macht Geld wirklich nicht glücklich?
Ist damit der Spruch bestätigt, dass Geld nicht glücklich macht? So leicht ist es nicht. Die meisten Menschen geben sich dem Traum vom Reichtum hin. Doch lehrt uns Manfred Spitzer in seinem Hörbuch "Glück ist....", dass der Gedanke an Geld reiche Menschen unglücklich mache, weil sie Neid fürchten. Ärmere Menschen hingegen könne eine gewisse Summe Geld glücklich machen.
Geld macht also nur dann glücklich, wenn genug davon vorhanden ist, um die Grundbedürfnisse zu stillen. Hier setzt auch der Soziologe Gerhard Schulze mit der Unterscheidung zwischen Fortuna und Felicitas an. Beides ist mit Glück zu übersetzen, doch auf unterschiedliche Weise.
Fortuna und Felicitas
Fortuna ist dem Zufall unterworfen und wird daher auch das blinde Glück genannt. Felicitas hingegen ist subjektiv geprägt. In seinem Aufsatz "Fortuna und Felicitas. Der hinkende Gang der Moderne" bezeichnet Schulze Felicitas als Versuch, sich sein Glück selbst zu gestalten.
Diese Idee, heute selbstverständlich in der westlichen Welt, stand am Beginn der Moderne. Gleichzeitig hoffen Milliarden Menschen aus China oder Indien darauf, zunächst einmal Fortuna zu erleben. "Sobald sie das 'Stadium des besseren Lebens' erreicht haben", so Schulze, "also Mobilität, Gesundheit, gute Wohnbedingungen und genug zu essen, steht ihnen derselbe Wertewandel wie in der westlichen Welt bevor." Streben nach Glück bekommt eine andere Bedeutung, es wird mit Tüchtigkeit gleichgesetzt.
Kaufen können wir Glück trotzdem nicht. Auch wenn Werbungen uns das täglich suggerieren und ihre Produkte in Kontext mit Glück stellen - wissenschaftliche Untersuchungen sprechen dagegen. Denn der Kauf eines ersehnten Gutes löst nur kurzfristiges Glücksempfinden aus, solange er einen Überraschungseffekt hat. Um Glück mit Konsum zu befriedigen, müssten wir mehr und mehr arbeiten und ob das uns glücklich macht, sei dahingestellt.
Hör-Tipp
Salzburger Nachtstudio, Mittwoch, 8. April 2009, 21:01 Uhr