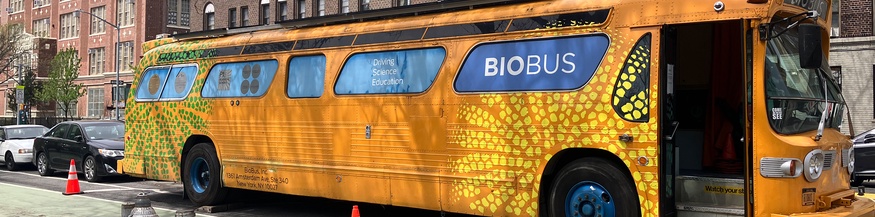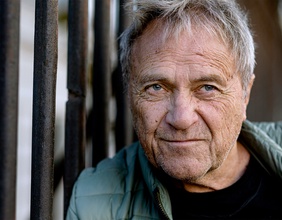Der Philosoph als Querdenker - Teil 4
Gegen die Vorherrschaft von Systemen
Philosophische Querdenker attackieren gesellschaftliche und ökonomische Hierarchien, die den Menschen einengen. Sie rufen dazu auf, sich von den Fesseln einer universellen Versklavung zu befreien und ein selbst bestimmtes Leben zu führen.
17. Jänner 2014, 14:46
Radiokolleg, 8. Mai 2008
Das Grundgefühl einer radikalen Entfremdung bestimmte das Leben und Werk des französischen Kulturtheoretikers Guy Debord, der von 1931 bis 1994 lebte. Debord war die Schlüsselfigur einer kleinen Gruppe von rebellischen Intellektuellen und Künstlern, die sich als "Situationisten" bezeichnete. Bereits in den späten 1950er Jahren formulierten sie eine radikale Kritik an der spätkapitalistischen Gesellschaft, die von der Protestbewegung des Mai 1968 aufgenommen wurde.
Debord sprach von der "Gesellschaft des Spektakels", die die gesamten Lebensbereiche des Menschen durch eine raffinierte Inszenierung verblendet und manipuliert. Diese kunstvolle Inszenierungen gaukeln den Konsumenten ein künstliches Paradies vor, die dem Einzelnen eine Befriedigung in Form von Scheinbildern anbieten.
Wider die Spektakelgesellschaft
Gegen die Scheinwelt der Spektakelgesellschaft setzte Debord die Geste der umfassenden Verweigerung, die von einer tiefgreifenden Melancholie begleitet wird. Debord und seine situationistischen Freunde fühlten sich als "Enfants perdus", als Kinder, die den Krieg gegen die "komfortable, reibungslose, vernünftige Unfreiheit der fortgeschrittenen Zivilisation" - so der Philosoph Herbert Marcuse - verloren hatten.
Debord glaubte nicht mehr an eine Revolution, sondern zelebrierte eine Art von melancholischen Nihilismus, der sich der Verwertungslogik und dem Produktionswahn der kapitalistischen Gesellschaft entzog.
Diese Haltung artikulierte sich bei Debord als kompromissloser Rückzug aus der Gesellschaft. Als "Enfant perdu" faszinierte ihn die Welt der Deklassierten, der sozial Stigmatisierten, der Bohemiens, die - ähnlich wie die antiken Kyniker mit ihrer Leitfigur Diogenes - die bürgerliche Welt boykottierten.
Für ein philosophisches Leben im Verborgenen
Gegen die Vorherrschaft von ideologischen Systemen wendet sich auch der in Basel lebende Kulturphilosoph Hans Saner. Auch er zieht es vor, sein Denken im Verborgenen zu entfalten. Seinen Denkraum versucht er von Konventionen frei zu halten, um für das Noch- nicht- Kodifizierte offen zu sein.
Im Unterschied zu den akademischen Philosophen nimmt Saner keine Trennung zwischen seiner Philosophie und seiner Existenz vor. Sein Anliegen drückt er nicht in einer abstrakten philosophischen Sprache aus, sondern spricht vielmehr von dem, was ihn existenziell bedrängt.
Saner bezeichnet seine Arbeit als "natürliche Dissidenz". Darunter versteht er die Bereitschaft, gesellschaftliches Unrecht aufzuzeigen. Das hat ihm in der Schweiz den Ruf eines unbequemen Gesellschaftskritikers eingetragen. Als kompromissloser Moralist attackiert Saner in Aufrufen, die er in Zeitungen und im Rundfunk publiziert, verschiedene staatliche Institutionen und ruft zum Widerstand gegen die "Verfallserscheinungen einer Demokratie" auf.
Dieses Grundgefühl ist wohl stellvertretend für die von der Antike bis zur Gegenwart reichende Internationale der Querdenker, deren Intention darin besteht, die versteinerten, herrschenden Verhältnisse zum Tanzen zu bringen.