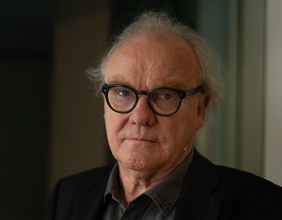Räuber, Mörder, Huren und Hehler
Opern, nicht für Opernsänger
Von Bettlern und Räubern in Händels London und Brechts Berlin. Wie aus John Gays "Beggar's Opera" die "Dreigroschenoper" wurde. Über ein barockes Erfolgsrezept, das einen Sensationserfolg auslöste. Ein Sprung über zweihundert Jahre Musikgeschichte.
8. April 2017, 21:58
Opern zu Dumpingpreisen, ja Opern, die sogar so wohlfeil dargeboten werden, dass sie sich sogar Bettler leisten können, weil sie nicht mehr als drei Groschen kosten. Es sind auch Opern, die so simpel sind, dass man für sie nicht einmal Opernsänger benötigt.
Es genügen schon ein paar Schauspieler, die Liedchen trällern können. Vor allem aber müssen sie fähig sein Räuber, Mörder, Huren und Hehler ebenso überzeugend darzustellen wie Polizisten.
Barockes Erfolgsrezept
Dieses Rezept hat schon 1728 in London einen Sensationserfolg ausgelöst. Es hat aber zwei Jahrhunderte danach, bei der Metamorphose einer Londoner in eine Berliner Verbrecherballade ebenso gut funktioniert. Nicht nur weil Kurt Weill für den Mackie-Messer-Song eine Melodie eingefallen ist, die diese Musik zum Schlager werden ließ.
Schlager hat es schon damals gegeben, im barocken London, als John Gay für seinen satirischen Text Melodien sozusagen von der Straße aufgelesen hat, Folk Songs, Tänze, Bänkellieder, dazwischen waren auch Nummern von Händel oder Purcell eingestreut, um sich über die musiktheatralischen Konventionen lustig zu machen.
Vor etwa zwei Jahrzehnten tauchten Krimisafaris durch die Unterwelt von Amsterdam auf dem Tourismusmarkt auf. Heute bieten die unterschiedlichsten Reiseveranstalter Einblick in die Verbrecherviertel so mancher Städte: etwa auf den Spuren des dritten Mannes in Wien oder von Jack the Ripper in London.
Gelungener Verfremdungseffekt
Wie ein so Reisender in einer fremden Welt mag sich auch ein Londoner Theaterbesucher von 1728 gefühlt haben, wenn er statt der gewohnten Händelschen Operntypen, Herrschern, Fürsten und Prinzessinnen aus Byzanz oder Rom, Diebe, Hehler, Räuber und Mörder als Personal der neuesten Theaterproduktion vorgesetzt bekam, in der "Beggar's Opera" von John Gay.
Eigentlich wurde die Form der Ballad Opera von John Gay erst für dieses unverhoffte Erfolgstück erfunden. Da der Aufwand gering bleiben sollte, wurde von Anfang an am Komponisten gespart. So gut wie Jedermann kannte die Melodien, für die Gay seiner Texte maßschneiderte, die Schauspieler konnten sie singen, das Publikum sie sich merken.
Ouvertüre im letzten Moment
Erst im letzten Moment beauftragte der Theaterdirektor John Rich seinen Hauskomponisten, den Deutschen Johann Christopher Pepusch, eine Ouvertüre zu schreiben und für den Generalbass zu sorgen. Und das schlug so ein, dass - nach einem geflügelten Wort aus dem barocken London - die Beggar's Opera John Rich gay gemacht hat, John Gay hingegen rich.
Die Story selbst, ebenfalls aus heterogenen Elementen zusammengesetzt, war einerseits moralisierende Satire, ganz wie damals auch die Kupferstiche von William Hogarth, andererseits Parodie der italienischen Oper, und darüber hinaus Dramatisierung eines wohlbekannten aktuellen Kriminalfalls, und ebenso offensichtliche Kritik am Premierminister Walpole und dessen Schwager Townsend.
Mit Hilfe der formalen Zwänge der "opera seria" (ein Happy End war Pflicht) bewahrte Gay seinen Helden Macheath vor dem Galgen. Zwei Akte lang hatten sich Ehefrau und Geliebte um ihn gestritten. Recht handfest sogar. Das sollte an die Händel-Primadonnen Cuzzoni und Bordoni erinnern, die kurz davor auf der Konkurrenzbühne einander derart in die Haare geraten waren, dass der Vorhang fallen musste.
Im Übrigen singen die Straßenräuber Gays einen Marsch aus Händels Kreuzritteroper "Rinaldo" als Aufforderung zum Überfall auf eine Kutsche: "Let us take the road". Soweit die Opernparodie.
Legendärer Schurke
Was den Kriminalfall betrifft, so teilte Gay den historischen Jonathan Wild, der neben seiner erfolgreichen Tätigkeit als "Diebsfänger" zeitweise in Newgate als Aufseher arbeitete und nebenbei Kutschenüberfälle organisierte bis er am Galgen landete, auf zwei seiner Figuren auf, von denen der eine der Hehler Peachum (peach, "betrügen"), mit dem anderen, Lockit ("versperr es"), einem Kerkermeister (bei Brecht: der Polizeichef Tiger Brown), befreundet ist.
Beide haben Töchter (Lucy und Polly), die beide den Räuber Macheath lieben, den folglich beide Väter unter Anwendung aller denkbaren Mittel los werden wollen. Gegen eine so unheilige Allianz kann dann nur mehr ein operngemäßer Deus ex machina helfen, der für eine Begnadigung in letzter Minute sorgt.
Schmissige Musik von Kurt Weill
Nahezu ident verläuft die Handlung bei Brecht, nur garniert mit der schmissigen Musik von Kurt Weill und den zynischen Formulierungen des Autors. Macheath Absicht, zu guter Letzt von der Straßenräuberei in das Bankfach überzuwechseln, begründete er mit überzeugenden Argumenten: "Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie, was der Einbruch in eine Bank, gegen die Gründung einer Bank. Und was ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes?"
"Der Räuber Macheath", schreibt Brecht, "ist vom Schauspieler darzustellen als bürgerliche Erscheinung. Die Vorliebe des Bürgertums für Räuber erklärt sich aus dem Irrtum: ein Räuber sei kein Bürger. Dieser Irrtum hat als Vater einen anderen Irrtum: ein Bürger sei kein Räuber."
Hör-Tipp
Musikgalerie, Montag, 2. Juni 2008, 10:05 Uhr