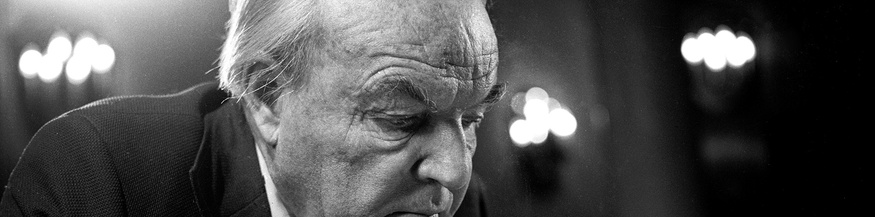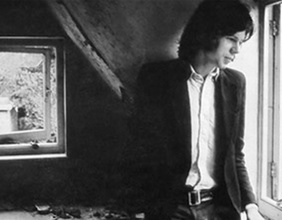Haydn - ein aufs Schloss Berufener
Das Schloss Esterházy
Wie seine Eltern ist Haydn ein aufs Schloss Berufener - er hat für die Unterhaltung der Adeligen zu sorgen. Doch das Schloss Esterházy war nicht immer ein Schloss, es war zwischendurch - nach seiner Zeit als Wasserburg - auch nahe dem Verfall.
8. April 2017, 21:58
Haydn örtlich - Teil 26
Ein Schloss - ist ein Schloss. Diese Feststellung ist so simpel nicht, denn sie zielt auf etwas Dialektisches, nämlich auf Ein- und Ausschließendes. In eine Lebenswirklichkeit übersetzt heißt das: man muss in ein solches Schloss erst einmal hineinkommen. Der Begriff des "Schlosses" hängt natürlich mit dem "schließen" und "geschlossen sein" zusammen. In Kriegszeiten schließt ein solches Schloss die Feinde aus, in Friedenszeiten die, welche ausgeschlossen werden, weil sie nicht mit eingeschlossen sind in den geschlossenen Raum einer Schlossgesellschaft. Und zu einer solchen gehört jemand, weil er in jenem geschlossenen Kreis zur Welt kommt, oder dorthin berufen wird. Menschen einer Schlosszugehörigkeit per Berufung haben aber dortorts durchaus keine bleibende Statt, kein Wohn-, sondern ausschließlich ein Arbeitsrecht. Erst die Tätigkeit versammelt die zu unterschiedlichstem Tun ins Schloss Berufenen unter das Dach desselben.
Für die Menschen, die in derartigen geschlossenen Zusammenhängen leben, ist all dieses eine Selbstverständlichkeit.
Aufs Schloss berufen wie die Eltern
Haydn mag sich erinnern an die Wege seiner Mutter und seines Vaters ins Harrach'sche Schloss zu Rohrau zum Zwecke des Kochens oder des Berichterstattens. Jetzt ist er selbst ein aufs Schloss Berufener.
Er hat dort Musik vorzuführen. Diese spielt - im wahrsten Sinne des Wortes - in der "Schlosskonzeption" seines fürstlichen Dienstgebers ihre klingend-repräsentative Rolle. Im großen Festsaal - er wird einmal den Namen Haydns tragen - ziert auch ein Bild des Musenführers Apollon die Decke. Adelige Hofhaltung - das ist auch ein wohlabgestimmtes Geflecht, in welchem die historisch gesicherte Abstammung und kulturelle Ambition miteinander aussagekräftig verbunden sein wollen.
Von der Front des Eisenstädter Schlosses blicken denn auch die sagenhaften hunnischen oder magyarischen Stammesführer herunter, von Árpád bis Töhötöm. Von denen abzustammen, das lassen sich die ungarischen Hochadeligen angelegen sein und bestätigen. Die, wenngleich wilden, so doch mächtigen Ahnen prägen gemeinsam mit den Heroen der Kultur die Imago einer Familie wie der Esterházy, sodass das Bild Töhötöms an der Schlossfassade in identitätsstiftender Logik und gleichberechtigt mit dem des Apollon im Festsaal gesehen sein will.
Von der Wasserburg zum Schloss
Der Eisenstädter Fürstensitz ist einmal eine Wasserburg gewesen, von der Familie Kanizsai zwischen 1388 und 1392 erbaut, als Schutz gegen das gerade habsburgisch gewordene Österreich. Die Esterházy, welche durch Graf Miklós 1622 das schon recht hinfällige Gebäude übernehmen, steigen durch ihre Treue und Anhänglichkeit zu den Habsburgern in die erste Reihe der Großen des Landes auf. Sie lassen die alte, ihrer Funktion sowieso beraubte Burg durch italienische Spezialisten zu einem durchaus herzeigbaren Barockbauwerk umgestalten. Vorbilder für Details sucht man sich in Österreich: in der Hofburg zu Wien und im Schloss Orth an der Donau im nordöstlichen Niederösterreich.
Das Schloss hat unterschiedliche Räume: etwa solche, die einladen, wenn man denn eingeladen ist, wie den großen festlichen Saal oder die nicht gar so große Schlosskapelle. Es gibt in diesem Schloss aber auch "geschlossene Räume" für mehr - nein eigentlich weniger - als nur "geschlossene" Gesellschaften. In diese zieht sich der Fürst zurück - Haydn wird ihm dahin folgen, in Ausübung seiner Musikerpflicht. Und der Fürst und sein Kapellmeister werden sich nicht nur in einem solchen innersten Raum des Schlosses, sondern gleichermaßen in den innersten Räumen der haydn'schen Kunst einschließen, und sie werden dort in gleicher, in gleichberechtigter Weise aufeinander angewiesen sein. Aber genauso wird es sein, wenn eine große Musik im festlichen Saal anbefohlen ist - da muss der Fürst sich und seine Gäste für die Dauer einer ganzen Symphonie dem Geist seines Kapellmeisters, nein, dem frei waltenden Genie Haydns überlassen.
Mehr zu "Haydn 2009" in oe1.ORF.at
Hör-Tipp
Haydn örtlich, jeden Montag, Mittwoch und Freitag bis einschließlich 22. Mai 2009, jeweils 15:06 Uhr
Links
austria.info - Joseph Haydn
Haydn 2009
Übersicht
- Haydn örtlich