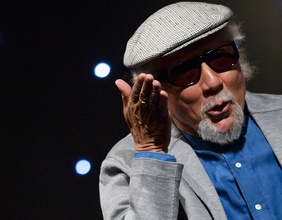Rundfunkgeschichte eines nicht mehr existierenden Staates
Antennen in den Köpfen
140.000 Filmbüchsen, 350.000 Musik-Tonträger, 100.000 Tonträger mit Wortsendungen sowie historische Realien des DDR-Rundfunks stehen im Deutschen Rundfunkarchiv der Wissenschaft als wichtige Quellen eines nicht mehr existierenden Staates zur Verfügung.
8. April 2017, 21:58
Das Deutsche Rundfunkarchiv, kurz DRA, ist eine Gemeinschafteinrichtung der ARD - der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. 1952 als Lautarchiv mit Sitz beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main gegründet, sammelt, archiviert, erschließt und dokumentiert das DRA Ton-, Bild- und Schriftdokumente von Funk und Fernsehen.
Nach dem Ende des Hörfunks und Fernsehens der Deutschen Demokratischen Republik wurde das Programm des Rundfunks 1994 an das Deutsche Rundfunkarchiv angegliedert. Das DRA führte die Archivbestände von 23 Standorten in Berlin-Adlershof, dem ehemaligen Sitz des DDR-Fernsehens, zusammen. Die Archivierungsbedingungen waren dort nicht optimal. Im Dezember 2000 erhielt das DDR-Rundfunkarchiv ein Gebäude auf dem Gelände des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Dort ist das Archiv in einem Neubau untergebracht.
Marlene-Dietrich-Allee 20
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Deutschen Rundfunkarchiv Babelsberg befinden sich die ehemaligen Ufa und Defa Filmstudios - jetzt Studio Babelsberg, der Filmpark Babelsberg und die Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf".
Im Rundfunkarchiv, das sich auf dem Gelände des Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) befindet, sind auf fünf Etagen 140.000 Filmbüchsen, 350.000 Musik-Tonträger, 100.000 Tonträger mit Wortsendungen, Programm- und Verwaltungsschriftgut von Hörfunk und Fernsehen, sowie historische Realien des DDR-Rundfunks archiviert.
In Fahrregalanlagen werden insgesamt ca. 6000 Laufmeter Schriftgut aus über 45 Jahren Rundfunkgeschichte aufbewahrt. Drehbücher, Hörspielmanuskripte und Regieanweisungen sind bei einer Temperatur von 17 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 50 Prozent archiviert, erzählt der Historiker Jörg Uwe Fischer, beim Interview. Er ist Leiter der Schriftgutbestände des Rundfunkarchivs.
"So klingt die DDR"
Im Schallarchiv befinden sich aufgezeichnete Sendungen, Eigenproduktionen des DDR-Rundfunks, Veranstaltungsmittschnitte, Film- und Hörspielmusik und das Geräuscharchiv - 36.000 Geräusche aus Umwelt, Arbeit und Verkehr standen den Mitarbeitern des DDR Rundfunks für den Einsatz in Hörspiel und Fernsehen zur Verfügung.
Eingefrorenes DDR-Fernsehen
Der Fernsehbestand erstreckt sich von der ersten Sendung am 21. Dezember 1952 bis zu Einstellung des Sendebetriebes am 31. Dezember 1991. Ausgangsmaterial ist 16 und 35mm Schwarzweiß bzw. Farb-Filmmaterial. Zur Erhaltung der Farbqualität werden die Farbfilme in Kühlkammern im Keller des Deutschen Rundfunkarchives archiviert. Der Sendebestand des DRA umfasst 100.000 Sendungen und 60.000 sogenannte Sujets vorwiegend aus der Nachrichtensparte.
"Rund"
Für Medienforscher ist das DDR-Rundfunkarchiv eine große Herausforderung. Wie zum Beispiel für Edward Larkey, Associate Professor for German Studies and Intercultural Communication an der staatlichen Universität von Maryland / Baltimore. Er recherchiert zum Thema Jugendsendungen im DDR Rundfunk.
Sein Hauptinteresse gilt dem Jugendmagazin "rund", dass einmal im Monat samstags um 16:00 im 1.Programm des DDR-Fernsehens ausgestrahlt wurde. In "rund" wurde Pop-Prominenz der 1970er Jahre wie Abba oder Hot Chocolate präsentiert, oft nachdem ihre Karriere im Westen schon vorüber war. Die Musik war Köder für politische Propaganda. Beispielsweise wurde der Vietnam-Krieg von Führern der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, kommentiert oder die Woche der Waffenbrüderschaft durch Vertreter der Volksarmee gefeiert.
"Prisma"
Ein weiteres Beispiel aus dem Rundfunkarchiv der DDR ist die Sendung "Prisma". In diesem Format wurde versucht die Probleme des Alltags der DDR-Bürger zu erfassen. Komplikationen bei der Heizmaterialversorgung, Wohnungssuche oder Autoauslieferungen wurden besprochen und die Beschwerden an zuständige staatliche Einrichtungen weitergeleitet: Das ist nahe am öffentlichen Auftrag einer Rundfunkanstalt könnte man meinen - der Seher bekommt eine eigene Stimme.
"Der schwarze Kanal"
Ganz anders war "Der Schwarzer Kanal". Ein Großteil der Haushalte in der DDR konnte "Westfunk" empfangen. Darauf reagierte die DDR-Führung mit einer politisch-agitatorischen Propaganda. Im Anschluss an dem in Ost- und West beliebten "Montagsfilm" wurden Ausschnitte aus dem Westfernsehen gezeigt und von Karl-Eduard von Schnitzler kommentiert.
Der "Schwarze Kanal" war die Antwort auf die Sendung "Die rote Optik", die von 1958 bis 1960 von Westdeutschland ausgestrahlt wurde und sich mit dem DDR-Alltag beschäftigte. Kalter Krieg im Äther! Der "Schwarze Kanal" wurde am 30. Oktober 1989 im Zuge der politischen Wende abgesetzt. Am 31. Dezember 1991 endete der Sendebetrieb des DDR-Fernsehens.
Hör-Tipp
Dimensionen, Montag, 10. November 2008, 19:05 Uhr
Buch-Tipps
Karl-Eduard von Schnitzler, "Der rote Kanal", Edition Nautilus
Dieter Segert, "Das 41. Jahr - Eine andere Geschichte der DDR", Böhlau Verlag
Hans-Hermann Hertle, Stefan Wolle, "Damals in der DDR - Der Alltag im Arbeiter- und Bauernstaat", Goldmann
Christoph Dieckmann, "Das wahre Leben im falschen - Geschichten von ostdeutscher Identität", Ch.Links Verlag
Link
Deutsches Rundfunkarchiv