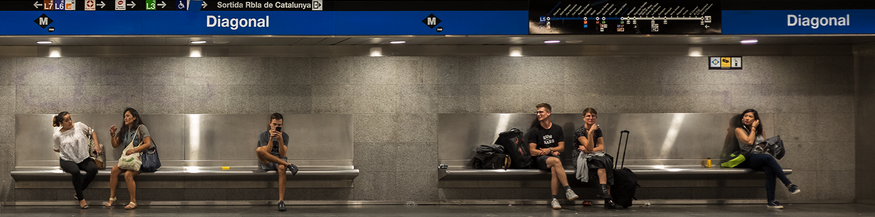Die psychische Dimension des Wünschens
Die Sterne vom Himmel holen
Wunsch und Wirklichkeit driften oft auseinander. Die ideale Beziehung, der perfekte Arbeitsplatz, die absolute Freundschaft sind Ansprüche, die in der Realität nicht bestehen können. Und trotzdem lassen sich diese Wünsche nicht zum Schweigen bringen.
8. April 2017, 21:58
Welche psychische Kraft haben Wunschvorstellungen, Wunschträume oder auch Verwünschungen? Was unterscheidet das Wünschen vom Verlangen, Wollen und Planen? In der Sprache der Psychoanalyse ist der Wunsch eine bewusst gewordene Äußerung der Lebensenergie, der Libido. Sigmund Freud beschreibt den Wunsch als einen Schlüssel zum Unbewussten, als Triebkraft, einen Traum zu formen.
Orientierungspunkte
"Wünsche sind für mich wichtige Orientierungspunkte", meint Carmen Unterholzer. Die systemische Familientherapeutin bietet Workshops zum Thema "Wünschen" an. Mit Hilfe von Märchen und literarischen Texten motiviert sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, über die Wünsche der Kindheit zu schreiben.
So habe sie sich als Kind innig das Buch "Die Kinderwelt von A-Z" gewünscht, aber stattdessen die "Struwelliese" geschenkt bekommen. Den Eltern sei es eben wichtiger gewesen, ihren Ordnungssinn zu wecken, als ihre Neugier und ihren Bildungshunger zu stillen, erzählt Carmen Unterholzer.
In dieser Geschichte, die sie im Workshop zu Papier bringen konnte, erinnert sie sich an die große Enttäuschung und daran, wie sie die Erfüllung dieses Wunsches imaginieren konnte. All ihren Freundinnen erzählte sie, dass sie das damals heiß begehrte Werk zu Hause hätte.
Wünsche verführen und versklaven
Ihr Bedürfnis nach Lektüre ist geblieben, ihren Wunsch nach Bildung konnte sie sich in ihrem Studium erfüllen. "Ich habe viel erreicht, weil ich immer wieder auf meine Wünsche achte", so die Therapeutin, die in der Kraft der Sehnsucht eine wichtige Ressource zur Persönlichkeitsentwicklung erkennt.
Ziel ihres Workshops ist, eine Art "Wunschzettel" zu schreiben, der konkrete Schritte zur Umsetzung der eigenen aktuellen Wünsche beinhaltet.
Die einen werden von ihren Wünschen verführt und versklavt. Den anderen wiederum sind ihre Wünsche Inspiration und kreative Kraft. Und was ist mit Menschen, die behaupten, wunschlos glücklich zu sein? "Die machen mir Angst", sagt die Psychotherapeutin Carmen Unterholzer. "Das sind oft Menschen, die sich das Wünschen verboten haben." Denn von Wünschen muss man sich manchmal auch verabschieden können, und das kann schmerzlich sein.
Anstelle des Wunsches trat die Erkenntnis
"Das Wünschen ist ein altmodischer Zustand", meint hingegen der Schriftsteller Michael Köhlmeier. Dem Wort "Wunsch" liege ein Bild zugrunde, das auf den Zauber der Welt vertraut. Doch seit der Aufklärung ist die Welt immer mehr entzaubert worden.
"Wenn wir vom Wünschen reden, dann tun wir so, als ob wir Weihnachten feiern, ohne daran zu glauben." Für Köhlmeier, der selbst Märchen und klassische Sagen neu erzählt, ist der Wunsch an Metaphysisches gebunden und braucht Adressaten, wie einen Gott oder eine übersinnliche Kraft.
Die Religionskritik, die mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert formuliert wurde, schaffte diese Adressaten ab. An wen sollten die Wünsche nun gerichtet werden? Der Wunsch wurde irrelevant. An seine Stelle trat das Streben nach Erkenntnis.
Hör-Tipp
Radiokolleg, Montag, 22. Dezember bis Mittwoch, 24. Dezember 2008, 9:05 Uhr
Mehr zu Angela Tröndle in oe1.ORF.at