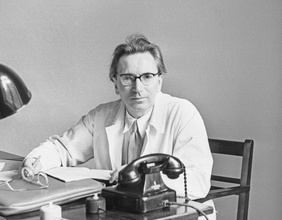Sind s' nicht schön bös?
Menschen und Figuren bei Ödön von Horvàth
Vor etwas mehr als 70 Jahren wurde der Dramatiker Ödön von Horváth in Paris von einem stürzenden Baum erschlagen. Unmittelbar darauf steckten jene seltsamen Figuren die Welt in Brand, deren Psyche der Dichter ahnungsvoll auf die Bühne gebracht hatte.
8. April 2017, 21:58
In Beiseln und eher zwielichtigen Kaffeehäusern sei er am liebsten gesessen, vor allem, wenn er in Wien war, das ja nun wirklich nicht seine Heimat gewesen ist, aber doch eine ihm gleichsam wesensverwandte Stadt. So ein österreichisch-ungarisches Mischmasch halt und von der Leere, die der Weltkrieg (der "Erste") hinterlassen hatte, erfüllt.
Horváth (ungarisch: "Kroate") stammte aus diplomatischer Familie, war 1901 in Rijeka geboren, das knapp hundert Jahre zuvor von den napoleonischen Franzosen Italien zugeschlagen worden war und deshalb - in italienischer Übersetzung seines Namens ("Fluss") - immer noch "Fiume" genannt wurde, das aber dennoch, wie ganz Kroatien, zum Königreich Ungarn gehörte.
"von" aus purer Bosheit
Horváth hieß "Edmund" wie sein Vater (ungarisch: "Ödön") und führte auch dessen beamtenadeliges "von" im Namen - das er nur ein paar Jahre lang, während seiner linkssozialistischen Schaffensperiode (zur Zeit der "Bergbahn" und der "Sladek"-Stücke) demonstrativ wegließ, um es aus purer Bosheit - als ihn nämlich die dogmatischen Kommunisten in Berlin um Bert Brecht und Erwin Piscator für sich zu verwenden gedachten - wieder hinzuschreiben.
Deutsch als Verlegenheitssprache
Ödön von Horváth hatte in wechselnden Schulen fünf Sprachen zu bewältigen, blieb aber dann bei Deutsch als der Sprache, in der er schrieb, weil er "nicht anders konnte" (Ö. v. H.), einem "ostalpinen" oder auch "süddeutschen" Kunst-Dialekt, von Bildungsjargon durchsetzt, den Horváth als Milieusprache ansah. Diese uneigentliche Verlegenheitssprache mit ihren Phrasen und entlarvenden Pausen ("Stille") sollte die Figuren charakterisieren, sie entlarven, ihre verlogene Dummheit bloßlegen.
Im Zeichen der Dummheit
"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit als wie die Dummheit", lautet bekanntlich das Motto der berühmten "Geschichten aus dem Wiener Wald", und es könnte als Motto über all seinen Stücken stehen. Horváth meinte "Dummheit" im ursprünglichen Sinn: die Dumpfheit, die stumpfsinnige Egozentrik, die Kommunikationsstörung, die sich in Redensarten und absurder Logik Luft zu machen sucht. In dem gefühllosen Emotionsgetue, dass das Leben oder man selber oder alles überhaupt halt so sei und dass es deswegen auch so sein müsse.
"Schau doch nicht so ironisch" sagt Horváths Karoline zu Kasimir auf dem Oktoberfest, und: "Zuschneider bilden sich immer gleich so viel ein." - Es sind typische, nein: charakteristische Horváth-Sätze, Zusammenstöße zwischen Ironie und bitterer Realität (die ja noch nicht die Wahrheit sein muss, ganz im Gegenteil).
Klassische Beobachtungsstation
Im Liliputanercafé in der Wiener Praterstraße habe er sich wohl gefühlt, und auch im Innenstadtlokal "Zum Weißen Rauchfangkehrer", das damals noch kein nobles Restaurant war, sondern von Horváth und Freund Lernet-Holenia scherzeshalber "Zum Schwarzen Tischtuch" genannt wurde. Und, übernächtig-hellwach, frühmorgens in den Markt-("Fieranten"-) Kaffeehäusern, an einem abgeschlagenen Kunstmarmortischchen, Menschen aufschreibend.
Da sei er dann, so erinnerte sich eine Freundin, melancholisch lächelnd gesessen, habe von seinen kleinen Bestien in den Stücken erzählt wie von alten Bekannten und habe manchmal, mit seinen großen braunen Augen aufblickend, gefragt: "Sind s' net schön bös? Sind s' net tierisch?"
Denn er habe die Menschen nicht geliebt. Er habe sie gesehen.