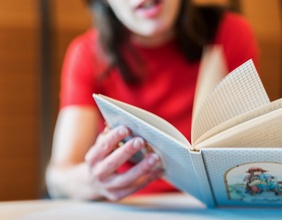Ein literarischer Außenseiter
Thomas Bernhard
Thomas Bernhard hat in allen autobiografischen Texten seine Position als Außenseiter immer wieder betont. Dass auch seine schwere Krankheit und die stets wache Sensibilität ihn von der Geselligkeit zurückhielten, macht seine Position verständlicher.
26. April 2017, 14:14
Thomas Bernhard hat sich am Rande aufgestellt. Er ist, wie er in seiner Autobiografie "Der Keller" sagt, in die entgegengesetzte Richtung gegangen und er ist das konsequent, ein Leben lang, gegangen. Er war außerhalb und diese Positionsbestimmung Bernhards ergibt sich aus seinen Werken und man kann sie durch sein ganzes Schaffen hindurch verfolgen.
Tiefe Spuren des Großvaters
Er war von Anfang an tatsächlich ein Außenseiter. Geboren als uneheliches Kind in den Niederlanden, wohin seine Mutter "verschickt" wurde, jemand der kaum ein Zuhause hatte. Nach der Geburt im Jahr 1931 kam er kurz nach Wien, von da nach Bayern, vor allem Traunstein.
Er wurde dann von seinen Großeltern erzogen, vor allem von seinem Großvater Johann Freumbichler, der in seinem Werk tiefe Spuren hinterlassen hat. Und von seinem Schulbesuch kann man auch sagen, dass er wohl eher zu den Außenseitern gehörte, zu jenen, die verschickt wurden, zunächst einmal ins Thüringische - wegen schwerer Erziehungsmängel, die er selber produziert hat.
In seinem autobiografischen Text "Der Keller" erzählt er, dass er plötzlich von der Schule gegangen sei, nichts mehr von dieser Mittelschule, die sei überhaupt völlig falsch, es gäbe nur eine Schule, eine Volksschule für die einfachen und eine Hochschule für die anderen, aber keine Mittelschule.
Bestechende Erzählprosa
Im Laufe der Zeit hat sich Thomas Bernhard dann doch sehr der Kunst zugewandt, der Musik, dem Schauspiel, aber auch dem Schreiben. Der Durchbruch erfolgt 1963 mit seinem Roman "Frost". Man kann sagen, dass dann bis zu seinem Tod im Jahre 1989 die Kette von Werken einfach nicht abreißt und jedes Jahr auf dem Buchmarkt ein Werk von Thomas Bernhard erscheint, das heftige Diskussionen, um nicht zu sagen größere oder kleinere Skandale, auslöst.
Bernhard war ein Autor, der vor allem durch seine Erzählprosa besticht. Er hat etwa 18 abendfüllende Stücke geschrieben, neun Romane, eine Fülle kleinerer Erzählungsbände, aber vor allem hat ihn etwas auch einer größeren Leserschaft bekannt gemacht und das waren seine fünf autobiografischen Bände. 1975 erscheint "Die Ursache", 1976 "Der Keller", 1978 "Der Atem", 1981 "Die Kälte" und 1982 "Ein Kind".
Diese fünf Bände haben ihn einer größeren Leserschaft erschlossen und sein Werk auch gewissermaßen als einen Teil dessen erscheinen lassen, was wir alle erlebt haben. Jeder konnte sich plötzlich mit Thomas Bernhard identifizieren oder gegen-identifizieren und so schlug diese Autobiografie sehr ein. Nicht zu verschweigen, dass natürlich gerade der erste Band, "Die Ursache", in dem er die Lehrerschaft Salzburgs, also das Gymnasium, heftig angriff, unerhört viel Staub aufgewirbelt hat und sogar einen Prozess - nicht selten bei Thomas Bernhard - zur Folge hatte.
Die Kunst der Übertreibung
In seiner Autobiografie wird natürlich nicht völlig authentisch berichtet, hier wird übertrieben. Und Thomas Bernhard übertreibt, es handelt sich aber um eine Übertreibungskunst. Hier stimmen die Zahlen des Öfteren nicht. Aber eine Tatsache stimmt: Thomas Bernhard berichtet von der schweren Erkrankung, die er sich holte und diese Erkrankung bestimmt sein ganzes Leben. Es ist eigentlich ein Schreiben unter der Signatur der Krankheit, die später dann noch viel deutlicher ausbrach. Es ist eine schwere Erkrankung, Morbus Boeck, die unweigerlich zum Tode führt. Und mit diesem Bewusstsein schrieb Thomas Bernhard seine Texte.
"Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt", hat er 1968 in seiner berühmten Staatspreisrede gesagt, eine Rede, in der er gewissermaßen den Fundamentalsatz seiner Ästhetik festgelegt hatte.
Bis zur Kenntlichkeit entsellt
Durch das Erscheinen der Autobiografie setzt förmlich eine neue Werkphase bei Thomas Bernhard ein. Man hat das Gefühl, der Autor, der vorher so abstrakt zu uns sprach, der also in seinen Büchern alles als künstlich bezeichnet hat, dieser Autor wird plötzlich konkret greifbar. Allerdings sind es weiter die Formeln, mit denen Thomas Bernhard zu überzeugen vermochte, nämlich jene Formeln, die in den All- und Existenzsätzen ihre Zuflucht finden.
"In Ischl halten alle allen alles dauernd vor." Es ist diese Neigung zum Superlativ, zu einem Extremvokabular, die dazu führt, dass man Thomas Bernhard öfter auch nicht gerne glauben wollte, weil man gemeint hat, hier wird die Übertreibung so stark, dass man den Wirklichkeitsgehalt nicht mehr herausfiltern könnte, aber gerade diese Übertreibungskunst ist es: Man muss übertreiben, um die Zustände zur Kenntlichkeit zu entstellen - ein Verfahren, das nicht von ungefähr an Brecht erinnern mag.
Rare Lichtfiguren
Die Autobiografie ist eine faszinierende Schilderung des Schülers Bernhard, des Lehrlings Bernhard, des erkrankten Bernhard und dann, als fünfter Band, eine Schilderung des kleinen Kindes Bernhard. Das heißt, er hat die Chronologie fast auf den Kopf gestellt und das Kind zeigt sich nun als ein widerspenstiges Individuum, das aufs Fahrrad steigt und auch einfach auf und davon fährt und dieses Motiv des Weggehens, des Ausbrechens, dieses Verlassens der Heimat spielt auch in den späteren Romanen eine große Rolle.
Bernhard geht nicht zimperlich mit seiner Umgebung um, aber es gibt dann doch immer Lichtfiguren, so sein Lebensmensch Hedwig Stavianicek, die er im Krankenhaus kennengelernt hat, so aber auch sein Großvater, der ihn zur Literatur geführt hat und dessen Leben er auf der einen Seite in seinen tragischen Zügen darstellt, auf der anderen Seite aber auch dessen Radikalität er doch auch einigermaßen kritisch exponiert.
Dieser Großvater wird zu einem verbindlichen Vorbild, gerade was die Radikalität, die monomanische Haltung gegenüber der Arbeit betrifft, selbst unter größten Entbehrungen am Schreiben festzuhalten und sich so auch wiederum selbst zum Außenseiter zu machen.
Mehr als Verweigerung
Es spielt keine unbedeutende Rolle in diesem Werk, jemand zu sein, der sich die Isolation gleichsam erschrieben hat und aus dieser Isolation heraus schreiben kann. Die "schaurige Lust der Isolation", wie Robert Musil das genannt hat, hat man als einen seiner Wesenszüge erkannt. Diese Isolation ist mehr als bloß eine Verweigerung, sie ist auf der einen Seite natürlich der Ausschluss aus der Gesellschaft, aber andererseits ist es nicht möglich, über die Gesellschaft zu schreiben, ohne von ihr ausgeschlossen zu sein. Und in dieser Paradoxie bewegt sich sein Werk.
Thomas Bernhard hat sich auch immer gegen ein Konsensmaximum gewehrt, immer dort, wo Übereinstimmung erzielt wurde, hat er zugeschlagen. Er war ein Meister wechselnder Gegensätze zwischen Authentizität und Nicht-Authentizität. Das Fiktionale erschien plötzlich als das Reale, das Reale als fiktional, das Komische als das Tragische, das Tragische als das Komische.
Service
Text: Wendelin Schmidt-Dengler, Ausschnitt aus seiner Ö1 Sendereihe "Literarische Außenseiter"
thomasbernhard.at