Konjunkturpaket Klimaschutz
Grün und gut
Klimaschutz als Konjunkturpaket? Ein green new deal zum Ankurbeln der Wirtschaft? Während Europas Politikern derzeit der Mut fehlt, an diese Idee zu glauben, setzen in den USA viele große Hoffnungen in sie. Vor allem in Kalifornien.
8. April 2017, 21:58
Wie Pilze sind zwischen San Francisco und San Jose Firmen aus dem Boden geschossen, die den Klimaschutz zu ihrem Geschäft machen wollen. Nach Mikroprozessoren und Internet-Revolution tüftelt man im Silicon Valley nun an Technologien, um die Erderwärmung zu bremsen.
Billigere Solarzellen, besserer Biosprit, effizientere Solarkraftwerke, marktreife Elektroautos und klimafreundliche Baustoffe - all das wird in der Ideenschmiede entwickelt. Cleantech heißt das Schlagwort für die neue Boom-Branche, erklärt Will Coleman vom Risikokapital-Investor Mohr-Davidow-Ventures in Menlo Park.
"Cleantech wird die Welt im 21. Jahrhundert ähnlich nachhaltig verändern wie die industrielle Revolution. Stromerzeugung und Energieeffizienz sind Bereiche, die 20, 30 Jahren lang vernachlässigt wurden. Doch das ändert sich jetzt. Technologien, die es ermöglichen, Energie intelligenter zu nutzen und das Klima zu schützen, sind gefragt."
Grüne Technologie, das Geschäft von morgen
Rund 200 Millionen Dollar haben Will Coleman und seine Kollegen derzeit in junge Cleantech-Firmen investiert. Dutzende andere Geldgeber aus der Nachbarschaft setzen auf dasselbe Pferd. 2007 steckten sie insgesamt 1,1 Milliarden Dollar in die Öko-Industrie des Silicon Valley - fast doppelt so viel wie 2006. Und die Zuwachsraten waren auch 2008 zweistellig. Grüne Technologie verspricht das große Geschäft von morgen zu werden.
Risikokapitalgeber wie Will Coleman sind das Schmiermittel der Innovationsmaschine Silicon Valley. Ihr Treibstoff, das sind die Ideen kluger Köpfe von Eliteuniversitäten wie Berkeley und Stanford. Ein typisches Beispiel dafür ist der Chemiker Brent Constantz.
Umweltfreundlicher Zement für die Baubranche
Der Standford-Professor hatte die Idee für einen umweltfreundlichen Zement für die Baubranche. Er entwickelte eine Methode, die die Zementindustrie vom weltweit drittgrößten CO2-Sünder zum ökologischen Musterknaben machen könnte. Statt das Treibhausgas Kohlendioxid in die Luft zu blasen, könnten es Zementfabriken künftig im großen Stil bunkern.
In einer Pilotanlage stellt die 2007 gegründete Calera Corporation, deren Chef Brent Constantz ist, täglich bereits über eine Tonne des grünen Zements her. Dabei strömen die Abgase eines Gaskraftwerks an der Pazifikküste durch die riesigen Meerwassertanks einer alten Fabrik. Die im Wasser gelösten Mineralien reagieren mit dem Kohlendioxid aus dem Schornstein. Der Prozess ähnelt jener Biomineralisation, mit der Korallen ihr Skelett bilden.
"Das Ergebnis ist ein mineralischer Schlamm, der aussieht wie Zahnpasta. Um ihn als Zement verwenden zu können, müssen wir ihn trocknen. Dazu nutzen wir die Abwärme des Kraftwerks, die sonst verpufft", erklärt Constantz.
Erste Tests
Weil Abluft, Abwärme und Meerwasser die einzigen Zutaten sind, ist Brent Constantz überzeugt, seinen klimaschonenden Kitt zum selben Preis herstellen zu können, wie klassischen Zement. Im Februar hat er seinen Durchbruch bei einem Baustoff-Kongress in Las Vegas publik gemacht. Jetzt müssen unabhängige Labors den Meerwasser-Zement testen.
Hält er, was der Stanford-Professor verspricht, böte er den Betreibern von Kohle- und Gaskraftwerken erstmals die Chance, ihre CO2-Bilanz fast zum Nulltarif auszugleichen. Sie müssten sich nur mit Zementherstellern zusammen tun und das neue Verfahren anwenden - schon hätten die über kurz oder lang drohenden CO2-Abgaben ihren Schrecken verloren.
Auto 2.0
Während Europas Politiker zaudern, wie viel Klimaschutz sie ihren Unternehmen in Zeiten der Wirtschaftskrise zumuten können, werden in Kalifornien Nägel mit Köpfen gemacht. Unter anderem auch im Bereich Mobilität.
Unter dem Motto Auto 2.0 arbeiten rund ein Dutzend Firmen an der Elektrifizierung des Individualverkehrs. Prominentestes Beispiel ist die Firma Tesla Motors, deren zweisitziger Elektro-Sportwagen dieses Jahr auch nach Europa geliefert werden soll.
In vier Sekunden von 0 auf 100
Der blaue Wagen, in dem auch schon Hollywoodstar Matt Damon saß, ist flach wie eine Flunder. Die Karosserie ist aus Kohlefaser, die Schalensitze sind eng, das Cockpit spartanisch. Betuchte Käufer wie George Clooney oder Arnold Schwarzenegger mögen das so und blättern für den Wagen gut 100.000 Dollar hin. Ein Display neben dem Lenkrad zeigt den Ladezustand der 450 Kilogramm schweren Batterie hinter den Sitzen. Sie besteht aus knapp 7000 Lithium-Ionen-Akkus, wie sie auch in Laptops zum Einsatz kommen.
Der Sportwagen schafft es in vier Sekunden von null auf 100. Schneller beschleunigt kaum ein anderes Serienfahrzeug. Über 300 Kilometer fährt das Elektroauto mit einer Batterieladung. Der durchschnittliche Amerikaner fährt nur 60 Kilometer am Tag.
Getankt wird nachts in der Garage, wenn Kaliforniens Windparks billigen Strom liefern, den sonst keiner braucht. Dadurch kostet die Tankfüllung nur ein paar Euro. Bei Tesla Motors ist man deshalb überzeugt, auch für die geplante Limousine Käufer zu finden.
Der Klimawandel als Chance
Den Planeten retten und dabei Geld verdienen: Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Im Silicon Valley glaubt man trotzdem daran.
Grün und gut - Kaliforniens Cleantech-Industrie sieht den Klimawandel als Chance. Und ist bereit, sie zu nutzen.
Hör-Tipp
Dimensionen, Mittwoch, 4. März 2009, 19:05 Uhr

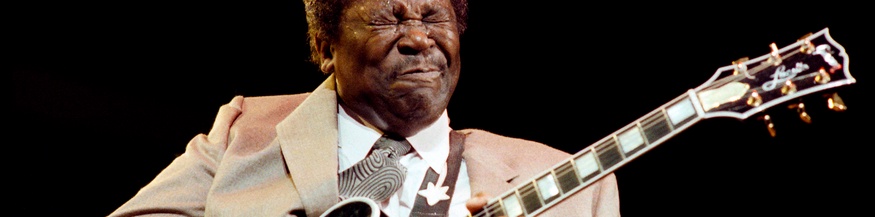

![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/2.0/DEED.DE|CC BY-SA 2.0] Ars Electronica Festival: Impressionen - Postcity](/i/related_content/be/0a/be0abe435ba816d5ee6c654aa7fcd6f770f4134e.jpg)
