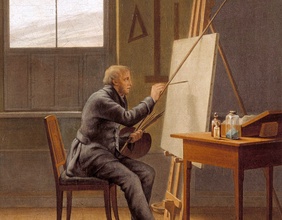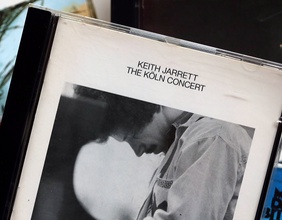Visionen und Perspektiven nach 20 Jahren Reform
Soziales Engagement in Osteuropa
Heuer verleiht die Erste Stiftung bereits zum zweiten Mal einen Preis für soziale Integrationsprojekte in Rumänien und im ehemaligen Jugoslawien, also in jener Region, in der die Bankengruppe auch wirtschaftlich besonders aktiv ist.
8. April 2017, 21:58
Franz Karl Prüller, Erste Stiftung
1.300 nichtstaatliche Initiativen zur Integration von Randgruppen und besonders benachteiligten Mitgliedern der Gesellschaft haben sich heuer um den Preis der Erste Stiftung beworben. 20 davon schafften es in die Endauswahl und wurden dafür mit Förderpreisen und ausdrücklicher Anerkennung belohnt.
Die ersten drei wurden gesondert ausgezeichnet. Es sind durchwegs Projekte, die mit viel - oft unbezahltem - Engagement getragen werden. Projekte, die manchmal auch von ihren eigenen Regierungen nur wenig Unterstützung erhalten und jetzt dabei sind, unter schwierigen Umständen jene sozialen Netzwerke zu stützen, und wieder aufzubauen, die im Zuge des politischen und wirtschaftlichen Wandels nach 1989 unter die Räder gekommen sind.
Soziale Sicherheit im Kommunismus
Dejan Petrović ist bei der Erste Stiftung für die Förderung von Sozialinitiativen zuständig. Er selbst stammt aus Serbien. Natürlich habe der Kommunismus viel Unglück gebracht, sagt er, jedoch habe es auf der anderen Seite in den kommunistischen Ländern auch gute Sozialleistungen gegeben. Mit dem Ende des Kommunismus sei auch die soziale Sicherheit verloren gegangen: "Plötzlich gab es überall sehr viele Menschen, die gesellschaftlich an den Rand gedrängt waren, um die sich niemand kümmerte, und die auch keine staatliche Sozialfürsorge mehr bekamen. Alte Leute, die ein Leben lang Beiträge gezahlt hatten, erhielten keine Pensionen mehr."
So gehen auch die Integrationspreise vor allem an Organisationen, die sich mit den neuen Problemen dieser Übergangsgesellschaften befassen, etwa an ein rumänisches Netzwerk, das sich um die Betreuung von Senioren in einer Region kümmert, wo das staatliche Sozialsystem nicht mehr hinkommt; an eine mazedonische Gruppe, die gegen Kinder- und Frauenhandel ankämpft und an junge Kosovarinnen, die Kriegswitwen in traditionellen Dorfgesellschaften helfen, auf eigenen Beinen zu stehen.
Die Gleichgültigkeit von Staat und Wohlhabenden
Florinda Rudi nimmt im Namen dieser Initiative den zweiten Hauptpreis entgegen. Sie kritisiert, die kosovarische Regierung, die es selbst nicht schafft, solche Projekte auf die Beine zu stellen: "Es sind nichtstaatliche Organisationen wie die unsere, die Zivilgesellschaft, die das machen. Die offizielle Sozialhilfe liegt bei 100 Euro, das ist zu wenig zum Leben. Aber so kann niemand sagen, dass die Regierung gar nichts tut."
In der aktuellen Krise werde jetzt auch die Unterstützung aus dem Ausland spürbar weniger, sagt Florina Rudi, und die Wohlhabenden, die es im Land selbst natürlich auch gibt, die würden sich nur sehr wenig engagieren.
Jasmina Dimischkowska, die Sprecherin der Initiative gegen Frauenhandel, die den ersten Preis gewonnen hat, verweist darauf, dass in Mazedonien der Staat nun langsam beginnt, mit privaten Initiativen bei der Bewältigung der immensen sozialen Lasten zu kooperieren: "Viele Jahre lang wurden die Nichtregierungs-Organisationen damit allein gelassen, die Regierung hatte Wichtigeres zu tun. Aber jetzt sind sie unsere Verbündeten."
Wirtschaftliche Stabilität durch soziale Sicherheit
Franz Karl Prüller, der 2005 von der österreichischen Caritas zur Erste Stiftung gestoßen ist, und jetzt Direktor für soziale Angelegenheiten ist, betont, dass soziales Engagement in den ehemaligen kommunistischen Ländern immer noch eine Randerscheinung sei: "Wir wollen das Signal aussenden, dass es unheimlich wichtig für die Gesellschaft ist, was diese Menschen tun." Außerdem sei es für die Erste Bank, als eines der größten Wirtschaftsunternehmen der Region, auch wichtig, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung im Auge zu haben: "In einer Gesellschaft, wo Menschen zusammenhalten und gut für sie gesorgt ist, ist auch die Wirtschaft in einem besseren Zustand."
Misstrauen in den Staat
Doch das private Engagement reicht offenbar nicht aus. Im begleitenden Symposium zur sozialen Lage in den Reformstaaten Mittel-Ost-Europas wird beinahe einhellig ein weiterer Punkt hervorgehoben: Der Staat muss in all diesen Ländern wieder stärker und effizienter werden.
Die Allmacht der kommunistischen Diktaturen hatte den Staat zunächst diskreditiert, nach der Wende von 1989 kam es in vielen Ländern zu Ablehnung und Skepsis gegenüber staatlichen Initiativen, alles musste privat und marktwirtschaftlich - heißt gewinnorientiert - werden.
Doch im Sozialbereich, bei Bildung, Gesundheits- und Altenfürsorge hat dies kaum funktioniert - mit ein Grund für die nachfolgende Misere in vielen Gesellschaften.
Hör-Tipp
Europa-Journal, Freitag, 3. Juli 2009, 18:20 Uhr
Link
Erste Stiftung