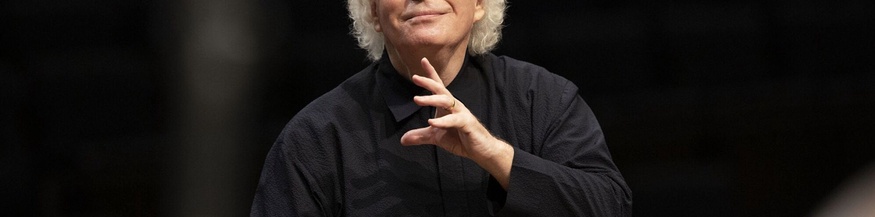Händel-Buch von Karl-Heinz Ott
Tumult und Grazie
"Tumult und Grazie" heißt Karl-Heinz Otts Buch über Händel. Er gießt das Füllhorn seines Wissens über den Leser und wie's herausrinnt, so muss es aufgefangen werden. Sein Aufzählen, Zitieren, Hin- und Herspringen wird stilistisch nicht bewältigt.
8. April 2017, 21:58
Karl-Heinz Ott näherte sich der Musik von zwei Seiten, von der akademischen, studierte er doch Philosophie, Germanistik und Musikwissenschaften, aber auch praktisch, in dem er in Freiburg, Basel und Zürich sowohl als Theatermusiker als auch als Operndramaturg arbeitete. Der 1957 in Ehingen bei Ulm Geborene schrieb drei Romane, ein Theaterstück, eine Heimatkunde des deutschen Bundeslandes Baden und brachte zuletzt unter dem Titel "Tumult und Grazie" bei Hoffmann und Campe ein Buch über Georg Friedrich Händel heraus.
Wenn im Einleitungskapitel dieses Händel-Buches unter dem Titel "Die stinklangweilige Barockmusik" Vorurteile gegen diese - wie sie vor dreißig, vierzig Jahren noch gang und gäbe waren - aufgelistet werden, anschließend ein wenig an Adorno herumgemeckert wird um dann gleich in die detaillierte Beschreibung einer Händel-Arie überzugehen, die dann nahtlos von einem Lob auf die Originalklangbewegung abgelöst wird, dann meint man, in dieser Einleitung zeigt einer, was er dann alles in seinem Buch - schön geordnet - bringen wird wollen.
Bach vs. Händel
Aber Karl-Heinz Ott macht so kunterbunt weiter. Er gießt das Füllhorn seines Wissens im Folgenden über den Leser und wie's herausrinnt, so muss es aufgefangen werden. Er hat viel gelesen, viel studiert und zusammengetragen, er zitiert, was das Zeug hält, von Händels Zeitgenossen bis in unsere Tage.
Wenn es um den immer wieder bemühten Vergleich zwischen Bach und Händel geht, dann lässt Ott einen merken, dass seine Vorliebe eher bei dem weltgewandten Händel liegt, den er immer wieder mit Shakespeare vergleicht, als bei dem Jenseits-süchtigen Bach. Er meint, dass Händels Musik "weil sie weniger verzwirbelt klingt - unmittelbarer anspricht, während diejenige von Bach mitunter eine Bewunderung hervorrufen kann, die ohne Rührung bleibt." Als ob Musik dazu da wäre, Rührung zu vermitteln.
Abschweifungen und Auslassungen
Schafft man es aber, sich durch die Zitatanhäufungen, Meinungsäußerungen, Abschweifungen und Auslassungen durchzuarbeiten, stößt man auf Stellen, in denen er einem seine Begeisterung sehr schön klar macht, so hört er zum Beispiel in dem opernhaften Oratorium "L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato" - Der Heitere, der Grübler und der Gemäßigte - "englisch-folkloristisch angehauchte, klassisch klar anmutende, sommerlich wirkende, tänzerisch beschwingte, bukolisch heitere Musik" und fragt sich an anderer Stelle, warum dieses Werk heutzutage zu seinen unbekanntesten zählt, wo es doch "lyrisch, leuchtend, jauchzend, anrührend mit Gesängen von ungebremster Freude und einer wahrlich arkadischen Heiterkeit" sei.
Sein andauerndes Aufzählen, Zitieren, Hin- und Herspringen wird von ihm auch stilistisch nicht wirklich bewältigt, somit liest sich das alles eher mühsam. Und wenn er sich in einem Kapitel Händels weitgehend unbekanntem Privatleben widmet, beginnt er gleich einmal mit dessen Sexualität und der Frage, ob Georg Friedrich nicht doch schwul gewesen sei.
Als Roman-Autor gelobt
Jetzt kann man natürlich keinem Autor, so auch Karl-Heinz Ott nicht, vorschreiben, wie er sein Buch hätte anlegen sollen, aber, seine Stärke liegt erwiesener Maßen eher im Belletristischen als im Essayistischen, ist er doch für seine Romane mit diversen Preisen ausgezeichnet und auch von der Kritik einschlägig gelobt worden, so zum Beispiel für seinen Roman "Endlich Stille", wo ein Kritiker meinte, dass er ein furioser Autor wäre und großartig im Einfangen von Atmosphäre.
So einer könnte doch eher Musik in Sprache umsetzen, Stimmungen einfangen und das alles in die wenigen abgesicherten biographischen Details hineinsetzen.
Barockes Wirrwarr
Ott aber referiert über Händels Hunger und das Duell in Hamburg, die verbotene und die verschmähte Oper, über Kastraten und andere Diven, über das schwer einzugrenzende Barock. Dieses Kapitel betitelt er "Barock und Wirrwarr" und man kann - wenn man will und unfair sein möchte - diesen Titel gegen den Schreiber verwenden. Er hat da so viel Gescheites, Inspiriertes über das Barock zusammengetragen, das alles aber nicht ordnen können, so dass der Titel gebende Wirrwarr bleibt.
Mit Pomp und Pifa endet Ott und was Pifa ist, nämlich die oboenartige Schalmei aus Italien, die Händel in der Zwischenmusik im ersten Teil des Messias einsetzt und die dem Stück dann auch gleich den Namen gibt, erklärt er natürlich. Er schließt dieses Buch, er schließt "Tumult und Grazie", mit der Feststellung, dass Händel viel eher neben Haydn zu stellen wäre als neben Bach. Und so gelingt es ihm am Ende doch noch, den Leser zum Nachdenken zu bringen, zum Widerspruch zu reizen oder Zustimmung zu erreichen.
Hör-Tipp
Apropos Musik. Das Magazin, Sonntag, 5. Juli 2009, 15:06 Uhr
Buch-Tipp
Karl-Heinz Ott, "Tumult und Grazie", Hoffmann und Campe