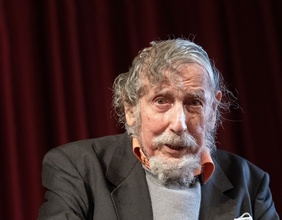Theatergeschichte anschaulich gemacht
Freihaustheater in Wien 1787-1801
Der Autor Tadeusz Krzeszowiak präsentiert mit seinem Buch "Freihaustheater in Wien 1787-1801" eine umfassende Geschichte des von Emanuel Schikaneder betriebenen Theaters, in dem die Uraufführung der "Zauberflöte" stattgefunden hat.
8. April 2017, 21:58
Das Freihaustheater in Wien hat sowohl musik- als auch theatergeschichtlich große Bedeutung: In diesem Theater ist Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte" unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt worden. Tadeusz Krszeszowiak hat in seinem Buch "Freihaustheater in Wien 1787-1801" nun neue, nicht leicht greifbare Details, aber auch bekannte geschichtliche Aspekte zu einem stimmigen Ganzen zusammengeführt. Das Buch umfasst Kapitel zum Theaterbau und zur Beleuchtung, zum Spielplan und zur Ausstattung des Theaters.
Der Autor, der sein Wissen in siebenjähriger Forschungsarbeit zusammengetragen hat, präsentiert bisher unveröffentlichte Baupläne des Theaters und auch Theaterzettel, die über die Zusammenstellung des täglichen Spielplans Auskunft geben. Gespielt wurden etwa Ritter- und Lustspiele, Pantomimen, Possen und Trauerspiele ebenso wie Singspiele und große Oper.
Theater in Naschmarkt-Nähe
Abbildungen von Stadtplänen und Stadtansichten erleichtern es den Leserinnen und Lesern, sich vorzustellen, wo das Theater einstmals stand: Das Freihaus war um 1790 ein Gebäudekomplex nahe des heutigen Naschmarkts, das dem Fürsten Conrad Balthasar von Starhemberg gehörte und das größte Zinshaus Wiens war. Der Komplex bestand aus sechs Höfen und 225 Wohnungen.
Die Oberdeutsche Staatszeitung berichtet im Jahr 1785: "Dieses ungeheure Haus ist selbst ein Städtchen en miniature: Es fasst eine Kirche, eine Apotheke, beinahe alle Handwerker und Künstler in seinem Umfang ein, kurzum, alles, was man in einer Stadt braucht."
Hochblüte unter Schikaneder
1787 wird das Theater eröffnet und erlebt unter seinem dritten Direktor, Emanuel Schikaneder, seine Hochblüte. Er veranlasst einen Umbau des Theaters, der nicht nur mehr Bühneneffekte ermöglicht, sondern auch Platz für mehr Zuschauer schafft.
Schikaneder beweist ein gutes Händchen, was die Auswahl der Stücke und der Schauspieler anbelangt. Theatergeschichtlich interessant ist, wie ein Schauspieler-Vertrag zur damaligen Zeit ausgesehen hat.
Benimm-Regeln für Darsteller
Im sogenannten "Bühnen Kontrakt" von Maria Josepha Hofer, Mozarts Schwägerin, datiert mit 9.Oktober 1790, schreibt Schikaneder etwa den Umfang der zu lernenden Rollen fest, aber auch, wie sich die Schauspieler zu benehmen hätten. Sie sind angehalten zu:
a) guter häuslicher Aufführung. b) Vermeidung des Schuldenmachens. c) Vermeidung aller Kabale. d) aller Unordnung, alles Zankes, Raufereien, Schlägereien, Nachtschwärmens, Rollen-Neides und Rollen-Streites, kurz alles desjenigen, was auch nur von der entferntesten Seite durch Muthwillen das Ganze der Gesellschaft und der Direktion beleidigen könnte. Bei der dritten deshalb zu machen nöthig seienden Erinnerung wird der betreffende Theil auf der Stelle sich der Abdankung zu unterziehen haben.
Nicht nur Emanuel Schikaneder und seiner Direktionszeit ist ein Kapitel in dem Buch gewidmet, auch Mozarts Leben wird noch einmal zusammengefasst. Da erfahren Leserinnen und Leser zwar nichts Neues, doch es rundet das Gesamtbild dieser Zeit durchaus ab.
Schwerpunkt Lichttechnik
Ein nicht unbedeutender Teil in Tadeusz Krszeszowiaks Buch ist dem Thema Theaterbeleuchtung gewidmet. Der Autor ist ein Fachmann auf diesem Gebiet - er war jahrelang für die Lichttechnik etwa im Theater an der Wien und dem Raimund Theater verantwortlich. Aus diesem Blickwinkel heraus ergeben sich selbst für den Theaterkenner Erkenntnisse in Bezug auf die Dramaturgie der Stücke und der Aufführungspraxis.
Was allerdings die Geschichte der Kerze und deren Herstellung betrifft, geht der Autor allzusehr ins Detail - das mag wohl eher technisch sehr interessierte Leserinnen und Leser ansprechen.
Bühneneffekte
Sehr anschaulich hingegen beschreibt der Autor die Effekte, die auf der Bühne eingesetzt wurden:
Besonders beliebt war der Himmeleffekt, wobei man das Licht der Kerzen oder Öllampen von zerritzten Metallflächen auf den Horizont reflektieren ließ und dadurch eine speziell glitzernde und schillernde Lichtart erreichte.
Brandgefahr im Theater
Für Feuer-Blitze hingegen hat man Kolophoniumpulver in einen Topf gefüllt, der einen durchlöcherten Deckel hatte. Beim Schütteln des Topfes entzündete sich das Pulver an einer Kerze, die auf dem Deckel befestigt war. Letztendlich waren es Effekte wie dieser, der die Brandgefahr im Theater erhöhte und den damaligen Eigentümer (Georg Adam Fürst zu Starhemberg) dazu veranlasste, den Mietvertrag für das Theater zu kündigen.
Durch die vielen detaillierten Schilderungen in dem immerhin 500 Seiten starken Buch entsteht im Kopf des Lesers ein buntes Bild Wiens, der Vorstadt und des Freyhaustheaters Ende des 18.Jahrhunderts.
Abbildungen schwarz-weiß
Die Phantasie der Lesenden wird durch die vielen Abbildungen von Theaterzetteln, Gemälden, Geburtsregistern, Fotos von Theatern und Fotos von Gedenktafeln unterstützt. Ein wenig schade ist nur, dass diese Bilder alle schwarz-weiß sind.
Theaterwissenschaftlich wertvoll ist der 100 Seiten starke Anhang des Buches - der Autor hat den täglichen Spielplan des Theaters vervollständigt. So wird deutlich, wie erfolgreich Mozarts "Zauberflöte" auch nach seinem Tod blieb. Was fehlt, ist ein Namens- und Begriffsregister, allerdings findet man sich durch die periodisch geliederten Inhalt leicht zurecht.
Das Auge stolpert
Ein Kritikpunkt sei noch angemerkt: Flüssig lesen kann man das Buch nicht, denn: Die Angaben der zitierten Quellen sind nicht als Fußnote vermerkt, sondern stehen im Fließtext. So stolpert das Auge ein wenig über die Quellenangaben hinweg. Das sollte den Leser aber nicht davon abhalten, sich in die Geschichte dieses Theaters zu vertiefen.
Fazit: Das Buch "Freihaustheater in Wien" ist eine Lektüre für Theater- und Musikinteressierte, die sich intensiv mit einem wichtigen Kapitel der Wiener Theatergeschichte auseinandersetzen wollen.
Buch-Tipp
Tadeusz Krzeszowiak, "Freihaustheater in Wien 1787-1801", Böhlau Verlag
Link
Böhlau Verlag - Tadeusz Krzeszowiak