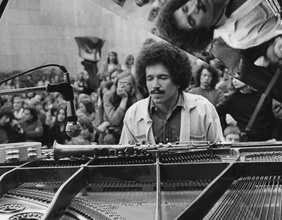Albin Skoda zum 100. Geburtstag
Inbegriff der Rhetorikkunst
Er war der Inbegriff aller rhetorischen Kunst. Dass Albin Skoda heute nur noch wenigen ein Begriff ist, hat gewiss mit seinem frühen Tod zu tun, aber auch damit, dass die rhetorischen Künste im Allgemeinen ein bisschen aus der Mode gekommen sind.
8. April 2017, 21:58
Kein Elternteil, weder Vater noch Mutter, hat je auch nur ein Wort gegen Schauspielschule und Bühnenlaufbahn gesagt, wie sich das in einer gutbürgerlichen Familie wie den Skodas eigentlich gehört hätte, niemand zweifelte an einer glanzvollen Bühnenkarriere für den Buben.
Im Gegenteil: An der Hand hat der Vater den Neunjährigen genommen und - es waren die allerletzten Tage des Ersten Weltkrieges in der unheimlichen Todesatmosphäre der sterbenden Residenzstadt - in die Burgtheaterdirektion geführt, am 1. November 1918. Dieses Datum trägt der Vertrag über die Darstellung von Kinderrollen, den der Vater, der Wiener Cafétier und begeisterte Laienschauspieler Albin Skoda für seinen Sohn, den kleinen Albin, unterschrieb. (Für das Burgtheater zeichnete damals der für kurze Zeit zum Direktor ernannte gute Onkel Hermann Bahr.)
Ein theatergläubiger Mensch
Albin Skoda junior, der späterhin gefeierte und wahrhaft umjubelte strahlende Liebhaber, Heldendarsteller und existenzialistische Grübler schlechthin - wenn der sagte, er wolle endlich den Hamlet als Rolle seines Lebens spielen - und er sagte es schon sehr bald, mit 24, in einem Zeitungsinterview - wenn Albin Skoda das sagte, dann lachte keiner. Albin Skoda war Hamlet, wie er nachmals Orlando und Marinelli, Jago und Zawisch, Mephisto und Faust und Don Karlos und überhaupt so gut wie alles war, was es für einen geborenen Klassiker unter den Schauspielern, einen Theaterbesessenen, für den es nichts Unerlernbares gab, nur zu spielen gab. Für einen, dessen erklärter Lebensinhalt das Burgtheater war, und der für dieses Haus lebte, weil er an seine Sendung, seine eigene und die des Burgtheater, glaubte.
Albin Skoda war theatergläubig. Und das war sicherlich zu einem guten Teil ein Resultat dieser Kindheit: Denn als man ihn mit neun zum ersten Mal an das Burgtheater engagierte (Mitglied des Hauses wurde er dann, nach kurzen "Provinz"-Jahren und einem Jahrzehnt in Berlin, 1946), da hatte der Knabe auch schon eine gewissermaßen öffentliche Vergangenheit: Albin Skoda senior, der Theaterbesessene, ließ Albin Skoda junior schon im Alter von sechs Jahren für eine Künstlerpostkarte posieren, die damals, im Kriegsjahr 1915, mit Fotografie und in bezwingender Unschuld vom "Kleinsten Vortragskünstler Wiens" kündete.
Sprach-Darsteller von genialischem Zuschnitt
Ernsthaft gezweifelt hat Albin Skoda nach solcher Schulung nie - weder am Theater noch an sich selbst. Allerdings: Er arbeitete ununterbrochen dafür.
Wenn ihm Kritiker und Kollegen ab und zu vorwarfen, er sei allzu verliebt in seine markante, quasi metallglänzende Stimme, in seine rhetorische Präzision (deretwegen man ihn besonders gern hintergründige Bösewichter spielen ließ), wenn jemand mäkelte, er sei ein Sprach-Darsteller von genialischem Zuschnitt, aber zu wenig Schau-Spieler, dann ging er in sich, arbeitete an seiner Körperlichkeit und legte binnen kurzem akrobatische Fechtszenen hin, die den Zuschauern den Atem raubten.
Als man ihn (dem auch große Ähnlichkeit mit dem legendären Ausdrucksmagier Josef Kainz nachgesagt wurde) zum ersten Mal den Hamlet spielen ließ, 1947 in Wien, fuhr er hinaus auf den Döblinger Friedhof zum Kainz-Grab, hielt dort eine Weile Zwiesprache mit dem 1918 früh Verstorbenen und nahm, gleichsam als Unterpfand, ein Efeublatt vom Grab, das sich, zwischen die gesammelten ersten "Hamlet"-Kritiken sorgsam eingelegt, in seinem Nachlass fand.
Allzeit bereit
Der stets Einsatzbereite ("Mit einem Albin Skoda können Sie immer rechnen, und wenn Sie wochenlang abwechselnd 'Die Räuber' und 'Faust II' auf den Spielplan setzen!"), der allzeit Gehetzte ("Wenn er einen Abend am Burgtheater frei hat, gibt er einen Rezitationsabend, hat er ein paar Tage frei, geht er auf Vortragstournee", konstatierte Hans Weigel, bewundernd, 1957), der unbeirrbare Träumer des Theaters schien zeitlebens damit befasst, in sich selbst, in die Rolle hineinzuwachsen, die ihm als Kind schon zugedacht und vorgegeben war.
Böse war er nur auf die Salzburger Festspiele, weil man ihn dort zwar hofierte und feierte wie an allen großen Bühnen, ihn aber nicht den "Jedermann" spielen ließ. Das verzieh er den Salzburgern nie und ging, ab 1954, alljährlich zu den deutschen Sommerfestspielen nach Bad Hersfeld, als Publikumsmagnet, dessen Anziehungskraft durchaus bis Wien reichte.
Albin Skoda starb im September 1961, knapp vor seinem 52. Geburtstag, an einem Schlaganfall in Wien. Dieser Tag war - und wer es erfuhr, wunderte sich nicht im Geringsten darüber - es war sein erster spielfreier Tag nach mehr als vier Wochen.
Hör-Tipp
Patina, Sonntag, 27. September 2009, 9:05 Uhr