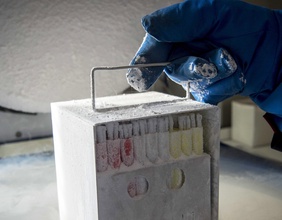Wie Demokratisierung gelingen kann
Gefährliche Wahl
Wahlen, von den reichen Geberländern als erster, entscheidender Schritt auf dem Weg zur Demokratie gepriesen, verstärken in vielen armen Ländern die Gewalt und vertiefen dort die Gräben. Diese Überzeugung vertritt der Ökonom Paul Collier.
8. April 2017, 21:58
Das Verhältnis zwischen der sogenannten Ersten Welt, also den reichen Industrienationen, und den "Ländern der untersten Milliarde", wie der Oxforder Ökonom Paul Collier sie nennt, war immer schon pikant. Oder - seriös ausgedrückt: das Verhältnis war stets asymmetrisch.
Ob die Länder der untersten Milliarde nun Kolonien waren oder bloß abhängig von Europa, ob die postkolonialen Gesellschaften sich während des Kalten Kriegs an die USA hielten oder an die Sowjetunion, ob heute enge wirtschaftliche Beziehungen zu den ehemaligen Kolonialmächten oder zu China gepflegt werden - immer geht der wachsende Wohlstand der einen Seite zu Lasten der anderen.
Wille ist nicht genug
Dass Wohlstand bloß eine Sache der Verteilungsgerechtigkeit ist und Armut theoretisch weltweit überwunden werden könnte, wurde oft schon festgestellt. Bloß: funktioniert hat es bisher noch nicht. Dabei kann man nicht einmal sagen, dass die reichen Länder nicht den Willen hätten, die armen zu unterstützen - nicht zuletzt wiederum aus Eigennutz.
Mehr als um Rohstoffe geht es in den Jahren seit der Auflösung der großen Machtblöcke um die globale Sicherheit. Arme Länder gelten als bevorzugte Rückzugsgebiete für Terroristen und die organisierte Kriminalität.
Daten und Fakten
Wenn es also ein Interesse der Reichen gibt, arme Länder stabiler, wohlhabender und sicherer zu machen - warum werden diese Länder nicht stabiler, wohlhabender und sicherer? Ein Grund liegt auf der Hand:
Wir haben offenbar die Schwierigkeiten unterschätzt und die falschen Merkmale der Demokratie in den Vordergrund gestellt: die Fassade anstelle der grundlegenden Infrastruktur.
Das Wort "offenbar" stört Paul Collier, denn er ist kein Mann der Spekulationen, er hat auch keine Theorien zur Hand, er beruft sich einzig auf Fakten. Das heißt: auf Daten. Das mutet auf den ersten Blick lächerlich an, denn wie sollen strittige Fragen der internationalen Politik mittels Statistiken beantwortet werden? Wie will er durch Zahlenvergleiche nachweisen, ob und wie Entwicklungshilfe oder Unterstützung beim Aufbau demokratischer Strukturen sinnvoll sind oder ob begrenzte Militäreinsätze zur Friedenssicherung Nutzen bringen?
Das übergreifende Problem der untersten Milliarde besteht darin, dass ihre Gesellschaften in der Regel zugleich zu groß und zu klein sind - zu groß in dem Sinn, dass sie zu unterschiedlich sind, um bei der Erzeugung öffentlicher Güter zusammenzuarbeiten, und zu klein in dem Sinn, dass sie bei der Bereitstellung des wichtigsten öffentlichen Guts, der Sicherheit, keinen Größenvorteil nutzen können.
Wahlen sind nicht alles
Mit dem Understatement eines Wissenschafters, der weiß, dass seine Methode vielleicht nicht wasserdicht ist, diejenige seiner Kritiker allerdings ebenso wenig, versucht Collier mit der Kombinationsfreude eines Sherlock Holmes Tatsachen zu interpretieren.
Er fragt sich etwa, ob die Durchführung von Wahlen in Ländern der Dritten Welt, die einen Bürgerkrieg oder eine Diktatur hinter sich haben, bereits ein Garant für demokratische Verhältnisse ist. Westliche Außenpolitiker neigen ja dazu, die Abhaltung von Wahlen als ausreichend anzusehen, um die politischen Eliten eines Landes zu legitimieren.
Aber jeder, der einigermaßen aufmerksam die Medien verfolgt, weiß, dass die Republik Kongo, der Sudan oder Afghanistan trotz Wahlen keine demokratischen Länder sind. Wahlen kann man manipulieren, man kann die Opposition einschüchtern, Wahlen können die Korruption fördern, weil man, anstatt den Willen von Menschen zu erzwingen, diesen nun kaufen muss und so weiter. Das ist uns alles nicht neu, Paul Collier aber versucht das zu beweisen. Durch Fakten. Durch Zahlen. Durch Vergleiche. Und immer wieder muss er feststellen: Wahlen erhöhen nicht den Lebensstandard der Wähler, sorgen nicht für Gerechtigkeit und dämmen die Gewalt nicht ein - und schon gar nicht minimieren sie die Gefahr von Bürgerkriegen.
Brüchige Postdemokratie
Mit der Förderung von Wahlen verfehlen die reichen, liberalen Demokratien ihr Ziel. Wir wollen die unterste Milliarde nach unserem Vorbild umgestalten, vergessen aber, wie wir dorthin gelangt sind, wo wir heute stehen. Auch wir haben es nicht mit einem einzigen Sprung geschafft - aus der Diktatur in die liberale Demokratie.
Eine liberale Demokratie allerdings, das verschweigt Collier, die schon wieder brüchig geworden ist, die von manchen Kritikern überhaupt in Frage gestellt und die als Postdemokratie bezeichnet wird, in der die Diskurse über Repräsentation wichtiger sind als jene über Werte; in der die Macht nicht wirklich vom Volk ausgeht, sondern von Lobbys. Insofern müsste Collier die Frage stellen, ob der Export dieser Demokratie tatsächlich wünschenswert ist, doch darauf lässt er sich nicht ein. Sein Demokratiekonzept ist ein weitgehend theoretisches.
Vorteil und Nachteil ethnischer Vielfalt
Nicht unproblematisch ist auch die Erkenntnis, dass sich Demokratie in multiethnischen Gesellschaften schwer durchsetzen lässt.
Die vorteilhaften Wirkungen ethnischer Vielfalt machen sich nur in höheren Einkommensniveaus bemerkbar. Vielfalt ist gut für Amerika, und auch wenn die zunehmende Vielfalt in Europa den Wohlfahrtsstaat schwächen mag, wird dieser Effekt durch die Belebung der Privatwirtschaft ausgeglichen. Für Kenia und die anderen Gesellschaften der untersten Milliarde ist ethnische Vielfalt dagegen schädlich.
Unter anderem deshalb, weil in diesen Gesellschaften die politischen Eliten viel für die ethnische Gruppe tun, der sie selbst angehören, und andere ausschließen.
Abgesehen davon, dass es diskussionswürdig ist, ob in Europa die Privatwirtschaft tatsächlich für den schwächelnden Wohlfahrtsstaat in die Bresche springt, kann man die ethnische Vielfalt in den armen Ländern nicht ernsthaft infrage stellen, auch wenn sie für die Entwicklung demokratischer Prozesse ein Problem darstellen mag.
Verantwortlichkeit und Sicherheit etablieren
Collier spricht aber tatsächlich von der notwenigen Überwindung der Vielfalt zugunsten eines nationalen Identitätsgefühls. Natürlich ist es nicht falsch, wenn eine Gesellschaft nach dem Prinzip der Gleichheit aller funktioniert, aber die Konstruktion eines Nationalstaates - auch das lehrt die Geschichte - fordert Opfer. Das sollte man zumindest erwähnen.
Erhobene und miteinander in Beziehung gesetzte Daten ersetzen keine Politik. Wenn Paul Collier zum Ergebnis kommt, dass sowohl der Export westlicher Demokratiemodelle als auch die herrschende Entwicklungshilfepolitik sich als wenig zielführend erwiesen haben und stattdessen politische und begrenzte militärische Interventionen besser wären, dann fordert er nichts Geringeres ein, als ein Überdenken des sogenannten Subsidiaritätsprinzips. Danach sollen Entscheidungen autonom und auf niedrigster Ebene erzielt werden.
"Sobald Verantwortlichkeit und Sicherheit, die jetzt fehlen, mit ausländischer Hilfe sicher etabliert sind, werden Gesellschaft und Wirtschaft selbständig Fortschritte machen", ist Collier überzeugt und am Ende doch ziemlich ins Spekulieren geraten. "Dann werden auch Faktoren greifen, die diese Entwicklung wie von selbst weiter vorantreiben", denn die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt. Paul Colliers Buch ist bei aller Fragwürdigkeit so mancher Behauptung als origineller Diskussionsbeitrag eine Lektüre wert.
Hör-Tipp
Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr
Buch-Tipp
Paul Collier, "Gefährliche Wahl. Wie Demokratisierung in den ärmsten Ländern der Erde gelingen kann", aus dem Englischen übersetzt von Klaus-Dieter Schmidt, Siedler Verlag
Link
Siedler Verlag - Gefährliche Wahl