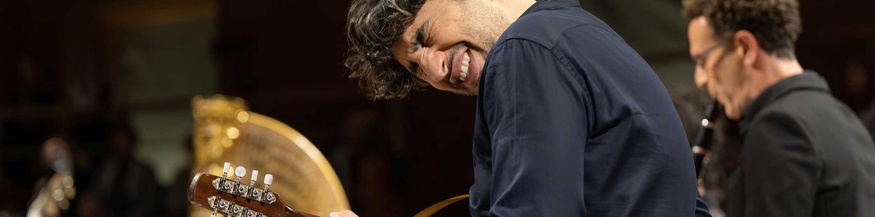Der Wiener Kaffeehausdichter Otfried Krzyzanowski
Was mich tröstet, ist der Hass
Er schien nichts als eine groteske Randerscheinung in den Wiener Literatur-Cafés zu sein, ein bizarrer Schnorrer, dem die Kaffeehaus-Besucher ab und zu eine Mahlzeit oder ein Bier spendierten. In den letzten Kriegstagen des Jahres 1918 ist er verhungert.
8. April 2017, 21:58
Dass einer symbolistisch zu dichten beginnt, kommt in den besten Lyrikerkreisen vor - aber Otfried Krzyzanowski lagen dergleichen Bemühungen um ästhetische Sinnbildlichkeit fern. - Und dass er selber im Lauf der Jahre - der wenigen, die ihm im kriegselendigen Wien und zwischen dessen düster erleuchteten Kaffeehausinseln gegönnt waren - eine Symbolfigur wurde, das war ihm wohl bewusst, sei ihm sogar, so meinten manche, zu Kopf gestiegen, war aber auch sein Schicksal, das er nicht zu beeinflussen, geschweige denn abzuwenden vermocht hätte.
Wenn er das nämlich überhaupt gewollt hätte.
Ein "Elends-Phänomen"
Ob Krzyzanowski, eine spindeldürre, zerlumpte Gestalt, die sich penetrant durch die literarische Kaffeehausgesellschaft der Wiener Innenstadt schnorrte, ob dieser Krzyzanowski ein bedeutender Lyriker war, wie manche, jedenfalls nach seinem Tod, glaubten, oder einfach nur eine literaroide Zeiterscheinung - als welche den armen Teufel einer seiner Gönner, Franz Werfel, in dem Roman "Barbara oder Die Frömmigkeit" festzuhalten versuchte (da nennt Werfel die Krzyzanowsi-Gestalt 'Gottfried Krasny' ein "Elends-Phänomen"); ob der bettelnde Hungerkünstler also bloß menschgewordenes und daher besonders lästiges Zeichen einer untergehenden Zeit oder tatsächlich Poet von zumindest respektablem Rang gewesen ist - das war damals, in den Jahren zwischen 1910 und 1918, da die Welten einstürzten und der Expressionismus die Wehklage darob einzufangen versuchte, im Fall Krzyzanowski kaum zu entscheiden.
Man sah ihn, sofern man Insasse des Café Central oder, später, des Herrenhof (ein paar Häuser weiter) war, tagtäglich von irgendwoher auftauchen, ein "Skelett von einem Menschen", schlurfenden Schritts sich den Tischen nähern und mit krächzender Stimme den ihm zustehenden Tribut einfordern. Er "verurteilte" (so formulierte es einer der Betroffenen, Alfred Polgar) die von ihm stechenden Blickes und zittrigen Zeigefingers Ausersehenen zu einem Mokka, einem Pfiff Bier oder gar einem Glas Wein und nährte sich im Übrigen von den altbackenden Semmeln, die ihm die Ober zukommen ließen.
Manchmal, wenn ihm einer nicht willfährig genug war, begann dieser seltsame Mensch, mitten im Kaffeehaus Gedichte zu deklamieren, eigene ebenso wie altgriechische Oden (was auf gymnasiale Bildung schließen ließ) oder apodiktische Urteile zu verkünden: Berühmt ist die Anekdote - Krzyzanowski wurde mit der Zeit zu einem wandelnden Anekdotenbündel und rächte sich dafür bei den Erzählern durch plötzliches Erscheinen in realer, nicht eben appetitlicher Gestalt - berühmt, sagten wir, ist die Geschichte mit Werfel, dem damals als lyrischer "Weltfreund" erfolgreichen Lyriker und angehenden Großromancier, der den ewig hungrigen Krzyzanowski großmütig zu einem Abendessen eingeladen hatte. Der Hungerdichter kam, aß und rächte sich für die Selbstgerechtigkeit seines Gönners, der seine Wohltat à tempo herumerzählt hatte, indem er am nächsten Tag inmitten des Herrenhof aus dem Parkettboden wuchs und schnarrend verkündete: "Werfel! Seit ich Sie essen gesehen habe, glaube ich Ihnen Ihr Christentum nicht mehr!"
Diese Geschichte wurde von den anwesenden Kollegen Werfels grinsend ad notam genommen - dem Autor brachte sie nur den (allerdings bald verrauchten) Zorn des Düpierten ein...
Wandelnder Zerrspiegel
Er, Otfried Krzyzanowski, ausgemergelt, unrasiert, leicht schielend, mit hängender Unterlippe, sei der hässlichste Mann von Wien gewesen, sagte man. Merkwürdigerweise ist bis heute keine Fotografie, nicht einmal eine Skizze oder Karikatur dieses doch offenbar immerhin sehenswürdigen Menschen aufgetaucht.
Die anekdotische Ungenauigkeit, mit der er wahrgenommen wurde, legt den Verdacht nahe, dass es zumindest teilweise die Hässlichkeit der Zeit, die Unfassbarkeit des Weltgeschehens vor dem Kaffeehausfenster, die Monstrosität des eigenen schlechten Gewissens war, die ihm, der sich weder wehren konnte noch wollte, da aufgebürdet und auf ihn projiziert wurde. Dass er ein wandelnder Zerrspiegel war. Noch dazu einer, der gleichsam zurückredete, auch und gerade, wenn er schweigend vor einem stand und ein paar Heller oder deren Gegenwert und Zigaretten verlangte.
Schmales Zettelkonvolut
Als Otfried Krzyzanowksi tot war, gegen Ende des letzten Kriegsjahres 1918, stellte sich heraus, dass sein lyrisches Oeuvre, vereinzelt in Zeitschriften gedruckt, aber sonst als schmales Zettelkonvolut aus seiner Untermiet-Wohnkammer in der Vorstadt geborgen, durchaus respektabel, in manchen Gedichten sogar bedeutend war. Dass seine in Bettelbriefen dann und wann geäußerte Hoffnung, aus seinem Talent doch einmal Kapital schlagen zu können, keineswegs unberechtigt war - er damit nur in die falschen Zeitläufte und wohl auch in die falsche Gesellschaft geraten war, die sein Umgang zu sein hatte, ohne dass er der ihre gewesen wäre. 1919 erschien ein Band Gesammelter Werke, die Manchen unter den Spöttern zum Verstummen brachte:
Über mein Elend
schreite ich eilend hin -
Sprich: wer weidet sich an mir?
Noch mein Schmähn ist Labsal eurer Gier.
(...)
Leicht ist doch und lang mein Schritt.
Und das Pflaster ist elastisch.
Was mich tröstet. Ist der Hass.
Gestorben an Entkräftung
Als der Dichter tot war, kam man auch darauf, dass er 1886 geboren war, zufällig in Bayern, nachmals in Wien tatsächlich das humanistische Gymnasium absolviert, dann aber die Familie verloren und von literarischer Produktion zu leben versucht hatte. Dass er vermutlich nicht nur wegen seiner schon damals ausgezehrten Gestalt, sondern auch wegen einer Tuberkuloseerkrankung selbst von den Kriegsmilitärs als untauglich zurückgewiesen worden sei.
Als der Dichter tot war, begann es sich auch langsam - und zum lähmenden Entsetzen seiner smarten Gönner - herumzusprechen, dass er wahrscheinlich gestorben war. Und zwar, so hieß es jedenfalls, am dritten Tag, nach welchem man ihn verlässlich im Kaffeehaus gesichtet hatte. An diesem Tag war man hinaus nach Währing in die Schulgasse zu dem Schuster geeilt, in dessen hofseitiger Werkstattkammer Krzyzanowski hauste.
Er hatte, völlig erschöpft auf seinem Strohsack kauernd, vergeblich versucht, jemanden dazu zu bewegen, seinen guten Freunden in der Stadt einen Zettel mit der Bitte um Essen und etwas Geld zu bringen.
Es wütete damals, Ende 1918, die Spanische Grippe, wie man weiß, der schon Ende Oktober, wie man ebenfalls weiß, beispielsweise der Maler Egon Schiele und seine Frau, beide noch etwas jünger als Krzyzanowski, zum Opfer fielen. Der Dichter Krzyzanowski freilich ist an der Spanischen Grippe verhungert. "Entkräftung" steht auf seinem Totenschein.
Ewig fremd
Eine spontane Sammlung für den Toten erbrachte 486 Kronen, genügend, um ihm ein Begräbnis auszurichten.
Eine ordentliche Handvoll namhafter Vertreter der Wiener Literatur jener Tage war am offenen Grab versammelt, und in diversen Erinnerungen wurde der tote Dichter noch einmal zur Anekdote: Wie gleich zwei Redner den Familiennamen nicht herausbrachten (obwohl das Polnische ja noch bis vor wenigen Wochen durchaus zum sprachlichen Kanon Großösterreichs gehört hatte und 'Krzyzanowski', als Herkunftsname aus mehreren Ortschaften Böhmens und Westpolens, gar nicht so selten war) - Aber es lag ja gar nicht an der vermeintlichen Namensexotik: Einer der Nachrufer verwechselte auch den Vornamen, einer der Totengräber vergaß die Schaufel im Grab.
Man konnte ganz einfach ihn, diesen Fleisch gewesenen Albtraum, gar nicht schnell genug aus den Augen haben und vergessen.
Carmen delirans, o Lied des Wahnsinns,
das Leben bist du: zwischen Tag und Nacht die Erschütterung.
(...)
Dies Eine wünsche ich nur,
dass mir der andern Sinnen
ewig fremd sei.
Hör-Tipp
Literatur am Feiertag, Dienstag, 8. Dezember 2009, 14:05 Uhr