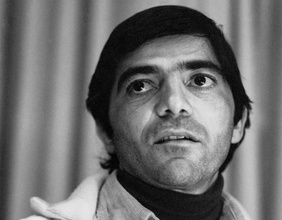Resonanzen in der akustischen Kommunikation
Labsal der Stille
Im Wachen, oder beim Schlafen: wir hören ununterbrochen. Akustische Signale liefern uns die Informationen, wo wir uns befinden und wer sich uns nähert oder ob Gefahr droht. Durch den Hörsinn sind wir mit unserer Umwelt und den Mitmenschen vernetzt.
8. April 2017, 21:58
"Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen ein", erklärte bereits 1843 der Naturphilosoph Lorenz Oken. Er definierte damit das Hören als basale Kommunikationsform des Menschen, die weder ausgeschaltet, verdrängt noch ignoriert werden kann. Denn Augen lassen sich schließen, Ohren nicht.
Aber genau da liegt das Problem. Denn unsere hochtechnisierte Zivilisation produziert einen stetig ansteigenden Pegel an Geräuschen. Und die Sehnsucht des modernen Menschen nach Stille wächst. Aber was ist nun diese Stille? Die Abwesenheit jeglichen Geräusches? Ein akustischer Freiraum, ein Ort der Kontemplation und Besinnung ? Oder eine isolierte Einzelzelle, wo jeder Kontakt zu den Mitmenschen unterbunden ist? Ist Stille eine Metapher für die Bewegungslosigkeit, den Stillstand, die Totenstarre? Oder die musikalische Pause, in der ein Ton ausklingt und der Musiker Atem schöpft bevor er neu ansetzt?
Wenn die akustische Reizüberflutung verhindert, einen klaren Gedanken zu fassen, wenn die Geräuschkulisse beherrschend ist und es nicht mehr möglich ist, seine eigenen Gedanken zu hören: Dann wird Stille zu einem Ort der Sehnsucht.
Im modernen Großstadtleben sind wir einem ständigen Geräuschpegel ausgesetzt. Diese permanente Beanspruchung stumpft unseren Gehörsinn ab, erklärt Herwig Swoboda, Leiter der HNO-Abteilung des Krankenhauses Hietzing. Denn ein Zuviel an Impulsen macht es uns schwierig, die Geräusche auch ihren Quellen zuzuordnen. Wir reagieren verwirrt. Und eine permanente Lautstärke bewirkt, dass wir nur mehr dumpf und farblos hören.
Anregende Stille oder gedämpfte Lautstärke?
Die Antworten auf diese Fragen richten sich nicht nur nach dem subjektiven Empfinden des Hörers. Denn Räume wie Tonstudios oder Schallkammern, die weniger als 20 Dezibel Grundgeräusch haben, werden als ebenso unangenehm empfunden wie die Beschallung durch mehr als 80 Dezibel.
Akustisches Wohlbehagen ist messbar. Und die Voraussetzungen dafür lassen sich diskutieren, wenn nicht sogar regulieren, erklärt der Komponist Peter Androsch. Als musikalischer Leiter von Linz 09 hat er mit seiner Hörstadt die akustische Umgebung zum Thema gemacht. Denn Schall ist Macht, sagt Peter Androsch, und Macht braucht Kontrolle.
Mit der "Linzer Charta" will Peter Androsch den akustischen Raum zum politischen Thema zu machen. Die bekannten Umweltschutzbestimmungen, die Wasser- und Luftqualität durch gesetzliche Regelungen schützen, sollen um den Klangraum erweitert werden. Die unterzeichnenden Stadtregierungen verpflichten sich, die akustische Belastung der Bürger zu begrenzen.
Linz hat diese Charta unterzeichnet. Mit der Erstellung eines akustischen Klangplans hat die Stadt Zürich einen weiteren Schritt gesetzt, eine akustische Raumplanung anzudenken.
Herausforderung an Architektur und Raumplanung
Doch: Wie lassen sich die Werte der "Linzer Charta" in konkrete Ziele verwandeln? Wie lässt sich die Lebensqualität der Menschen im akustischen Raum verbessern? Für Peter Androsch sind in der konkreten Umsetzung in erster Linie die Stadtplaner und Architekten gefordert, neue innovative Wege zu beschreiten.
"Die Mobilität der Bevölkerung ist sicherlich der wichtigste Faktor in Sachen Lärmbelästigung. Das lässt sich schwer ändern. Was sich jedoch ändern lässt, ist die architektonische Gestaltung der Städte. Denn heute werden vor allem schallharte Baumaterialen verwendet, wie Beton, Stahl und Glas, die bis zu 97 Prozent des Schalls reflektieren, den Schall einfangen und nicht weglassen. Hier können auch schalldämpfende Materialien verwendet werden."
Das Schweigen des Analytikers
Wir leben in einer Welt der Geräusche. Jede Bewegung löst auch eine Schallwelle aus. Es sei denn, wir bewegen uns im luftleeren Raum. Aus der Perspektive menschlicher Lebenserfahrung bedeutet absolute Stille einen Stillstand und Tod.
Aufmerksame Stille hingegen bietet den Raum, innere Vorstellungen zu entwickeln, die Abgründe aber auch die Ressourcen der eigenen Person kennen zu lernen und sie in das alltägliche Leben zu integrieren. Der Ort dieser Begegnung ist oft die psychoanalytische Praxis. Für Elisabeth Skalé von der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung schafft das Schweigen des Analytikers die Möglichkeit, zu reden.
Schweigen ist nicht nur ein bewusster Akt. Schweigen löst auch unterschiedliche Erinnerungen aus. Wenn der Analytiker oder die Analytikerin merkt, dass beim Patienten durch das Schweigen unangenehme Gefühle ausgelöst werden, darf er oder sie dieses Schweigen nicht vorschnell unterbrechen. Denn gerade am Beginn einer analytischen Begegnung kann das Gefühl, das durch das Schweigen ausgelöst wird, direkt zum Kern eines Problems führen, je nachdem, wie der Klient Schweigen erlebt hat. Und oft werden diesen Stunden richtungsweisend.
Die Stille in der Musik
Doch: Wie hängen Klang und Stille zusammen? Was bedeuten die Pausen? Und: Gibt es auch eine Stille in der Musik? Für den Dirigenten Franz Welser Möst ist Stille nicht die Abwesenheit von Ton, sie ist ein gestalteter Raum. In der Musik eröffnet die Stille für ihn Wege zu unbekannten Welten, auf der Suche nach dem einen, seinen ureigensten Klang.
Hö-Tipp
Salzburger Nachtstudio, Mittwoch, 20. Jänner 2010, 21:01 Uhr