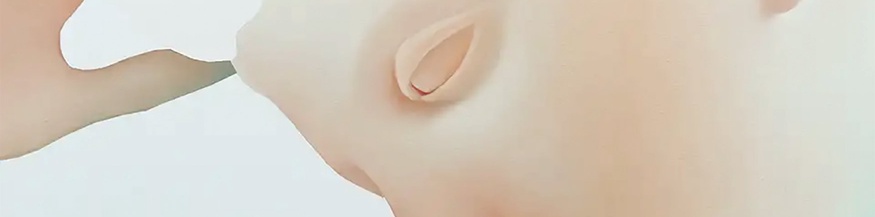Aribert Reimann und das Freilegen von Schichten
Opernfiguren in Extremsituationen
"Konstruktion ohne Emotion? Kann ich nicht!" Mit "Literaturopern", in denen er seinen Figuren in Extremsituationen nachspürt, ist Aribert Reimann zum meistgespielten deutschen Komponisten seiner Generation geworden.
8. April 2017, 21:58
Wer, wie die Wiener Staatsoper mit "Medea", ein Werk bei Aribert Reimann in Auftrag gibt, dem Berliner Jahrgang 1936, dem bedeutendsten deutschen Opernkomponisten in der Generation zwischen Henze und Rihm, zugleich dem Opernkomponisten, dessen Stücke auch am meisten nachgespielt werden, bekommt sicher nichts Modisches und nichts Gefälliges. Dafür aber etwas, das bei aller Komplexität und Neigung zu Schärfe und Attacke derart für Stimmen geschrieben ist, wie das kein anderer Komponist in dieser Kombination bietet.
Die kantablen Passagen in der Partie der Cordelia sind "Opernkonzert"-tauglich. Dann wieder werden im aufröhrenden Clusterklang des Riesenorchesters der Schmerzensschrei der Kreatur und das Toben der Elemente eins. Die Uraufführung von Aribert Reimanns "Lear" 1978 an der Bayerischen Staatsoper war einer der Schlüsselmomente fürs Musiktheater des 20. Jahrhunderts. Bei aller Durchorganisiertheit der Musik: Dramatische Wucht, heftigste Attacke, scharf skandierter Sprechgesang - und dazwischen Existenziellstes in einem archaischen Deklamationston, der nach keiner Kompositionstechnik fragt. Das Werk angeregt und die Titelpartie gesungen hat Dietrich Fischer-Dieskau.
Liedbegleiter wird Liederkomponist
Mit Fischer-Dieskau, aber auch mit Ernst Haefliger, Elisabeth Grümmer, Rita Streich, später dann mit Brigitte Fassbaender, zuletzt mit seiner Schülerin Christine Schäfer hat Aribert Reimann in seinem Erstberuf gearbeitet: als Klavierbegleiter. Das Lieder-Komponieren ergab sich logisch für Reimann. So, und nicht in den Avantgarde-Musikzentren der Zeit, Donaueschingen und Darmstadt, wurde sein Name bekannt.
Von seinem Berliner Kompositionslehrer Boris Blacher übernahm er die Haltung, nicht den Stil. Die Begegnung mit der Musik von Berg und Webern beeindruckte; die strenge Schönberg'sche Reihentechnik empfand Reimann jedoch bald als ein zu enges Korsett. Bei einem Musikwissenschaftsstudium an der Universität Wien blieb er an der Ethnomusikologie hängen: Faszinosum indische Musik!
"Gespenstersonate" für die 72-jährige Martha Mödl
Die Geschichte des Opernkomponisten Aribert Reimann beginnt in den 1960er Jahren, mit einem "Traumspiel" nach Strindberg - problembeladen, groß besetzt, schwer -, dem als Gegenstück die fürs Schwetzinger Festspiel-Rokokotheater geschriebene "Melusine" folgt - Kammerorchester, silberne Klangflächen, filigrane Koloraturen. Heute wird "Melusine", deren Nixen-Hauptfigur sich gegen die Verbauung ihres Lieblingsparks stemmt, gerne als Reimanns "Öko-Oper" aufgefasst.
Die langen Abstände zwischen Reimanns Opern - meist sind es sechs, sieben Jahre - machen es ihm möglich, sich musikalisch nicht zu wiederholen: Jedes Stück hat seine Farbe, seinen Klang, seinen Gesangsstil. Oft folgen, wie schon bei "Traumspiel" und "Melusine", Werke aufeinander, die Gegensatzpaare bilden: So komponierte Reimann, um vom massiven "Lear" und seinen riesigen Dimensionen wegzukommen, in den 1980er Jahren für "Gespenstersonate" (wieder nach Strindberg) eine bis aufs Skelett reduzierte Musik für nur zwölf Spieler. Die Vokalpartien wollen schneidend präzise deklamiert sein, kantable Episoden sind rar. So sparsam der Satz, so dicht ist das motivische Gewebe, und der Eishauch des Unheimlichen weht. Martha Mödl war bei der Uraufführung "die Mumie"; noch mit 88 machte sie "Die Gespenstersonate" zum Ereignis.
Literaturopern - Frauenopern
Immer Literaturopern bei Reimann, fast immer mit Frauenfiguren im Zentrum. So war es bei Reimanns letztem Bühnenwerk vor "Medea", "Bernarda Albas Haus" mit dem Sprechstück von Federico Garcia Lorca als Grundlage und dementsprechend kantig, karg, bedrückend. So war es auch bei "Troades", der Troerinnen-Kriegsparabel, die Franz Werfel nachgedichtet hat. Dem Andenken seiner Mutter, einer "Trümmerfrau" im Berlin des Jahres 1945, widmete Aribert Reimann "Troades".
Im "Troades"-Orchester fehlen die hohen Streicher ganz, während die tiefen bis ins Solistische aufgesplittert und zu farbigen Akkorden und dichten Tontrauben geballt und geschichtet werden. Wild gezackt sind die vokalen Linien: In Intervallsprüngen von der Non bis hin zu fast zwei Oktaven, mit ekstatischen Kapriolen und endlosen Koloraturketten.
Antiken-Oper nach Grillparzer
Nach "Troades" ist "Medea", die am 28. Februar 2010 an der Wiener Staatsoper ihre Uraufführung erlebt, wieder eine Antiken-Oper. Aus Grillparzers "Goldenem Vlies" kommt die Textvorlage, von deren bildhafter Sprache Reimann schwärmt. Bei den Proben ist er ständig anwesend, bereit für Ratschläge, nicht bereit, noch eine Note zu ändern.
Er hat, während der Entstehung der Oper, Jahre gemeinsam mit Medea, Jason und Kreusa gelebt und das getan, was er "Schichten freilegen" nennt: sich derart in die Figuren eingelebt, dass das Orchester ihre Gedanken Klang werden lassen kann, noch ehe sie Wort werden. Beim Interview liegt die Partitur aufgeschlagen: Rhythmisch verästelt im sparsam gesetzten, immer wieder pausierenden Orchester, bis an die Grenzen des Möglichen anspruchsvoll in den Gesangsstimmen.
"Gegenhalten" gegen die Oberflächlichkeit
Mit "Lear" hat Aribert Reimann die Oper geschrieben, an der Giuseppe Verdi, dessen nicht realisiertes Lebensprojekt ein "Re Lear" war, scheiterte. Die erwähnten Jahresabstände zwischen den Opern eingerechnet, wäre Reimann beim nächsten Bühnenstück im besten "Falstaff"-Komponier-Alter.
Wird es einmal eine "komische Oper" von ihm geben? Er winkt ab: Groteske Komik, immer an der Kippe, immer am Abstürzen, so wie es sie in seiner Oper "Das Schloss" nach Kafka, Berlin 1992 gibt, die ist sein Fall. Aber um etwas in "komischer" Operntradition zu schreiben, dafür hat sich ihm die Welt zu sehr verändert: "Wir werden ja zugedeckt mit Comedies, immer mehr und mehr. Alles wird immer oberflächlicher, da kann man nur gegenhalten!"
Mehr dazu in oe1.ORF.at
Jubel bei Reimanns "Medea"-Premiere
"Medea"-Varianten aus vier Jahrhunderten
"Medea"-Uraufführung in der Wiener Staatsoper
Hör-Tipp
Aribert Reimann: "Medea", Sonntag, 28. Februar 2010, 19:30 Uhr
Veranstaltungs-Tipps
Aribert Reimann, "Medea", Sonntag, 28. Februar, Mittwoch, 3. März, Samstag, 6. März, Dienstag, 9. März, Freitag, 12. März 2010, 19:30 Uhr, Wiener Staatsoper
Aribert Reimann, "Die Gespenstersonate, Samstag, 27. Februar 2010, 19:30 Uhr", Wiener Kammeroper
Links
Wiener Staatsoper
Wiener Kammeroper
Schott Music - Aribert Reimann