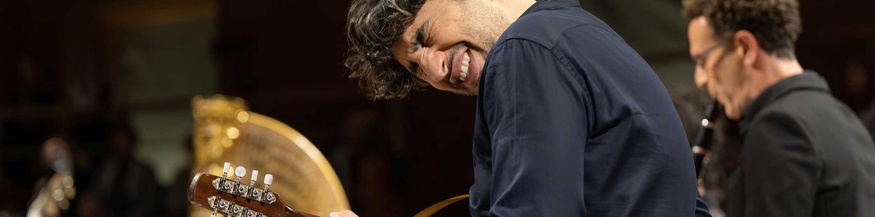Recht oder Unrecht - Teil 1
Wie sich unser Rechtsbewusstsein verändert
Wenn sich der Held eines US-amerikanischen Krimis auf sein Recht zur Notwehr beruft und frei gesprochen wird, könnte er in Österreich im gleichen Fall zur Verantwortung gezogen werden. Recht und Rechtsprechung sind national unterschiedlich.
8. April 2017, 21:58
Gesetze sollen ein reibungsloses Zusammenleben garantieren. Sie sind die Richtlinien für eine funktionierende Gesellschaft. Doch diese verändert sich stetig. Welche Gesetze sind veraltet und welche neuen Regelungen stehen aus? Trotz aller Novellierungen und Adaptierungen gewähren Gesetze aber immer einen Spielraum, sagt der Berliner Medienrechtsexperte Peter Schiwy. Und dieser ist von einem aktuellen Rechts - oder Unrechtsempfinden beeinflusst.
Rechts- und Unrechtsempfinden verändert sich
"Im Jahre 1957 entschied der oberste Verwaltungsgerichtshof der Bundesrepublik Deutschland, dass ein Major, der Ehebruch begangen hatte, unehrenhaft entlassen wurde: Obwohl dieser die neue Beziehung legalisierte und seiner geschiedenen Frau Alimente zahlte. Für das damalige Rechtsempfinden war er als Vorbild für junge Soldaten untragbar", erzählt Peter Schiwy.
Im selben Jahr verbot das höchste Strafgericht den öffentlichen Verkauf von Kondomen. Automaten mussten aus dem öffentlichen Raum wieder entfernt werden. Dreißig Jahre später verteilten Schulpolitikerinnen Kondome an Maturanten und Maturantinnen. Ihre Absicht war, auf die Aids-Prävention aufmerksam zu machen. In dieser kurzen Zeit habe sich "Volkes Meinung" geändert, so Peter Schiwy.
Doch was ist nun Recht - und was Unrecht? Beeinflusst unser Rechtsbewusstsein auch richterliche Entscheide? Oder gelten Normen, die tagespolitische Überlegungen überdauern? Sind Rechtsgrundsätze ein notwendiges Korrektiv von kurzfristigen und manchmal kurzsichtigen politischen Beschlüssen?
Grundlagen des Rechtsstaates
Für den Österreichischen Juristen Hans Kelsen war eine objektive Rechtsordnung die Grundlage des Rechtsstaates. Alle geltenden Rechtsnormen, die im Rahmen dieser Rechtsordnung beschlossen werden, müssen immer wieder an der Grundnorm überprüft werden. Sie definiert, was Recht ist, sagt Jürgen Wallner vom Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien.
"In der Tradition der Wiener rechtspositivistischen Schule, der Hans Kelsen angehört, ist alles Recht, was formell richtig ist. Wer sich an Bescheide, Verordnungen und Gesetz hält, bewegt sich im Recht."
Hans Kelsen war einer der Architekten der Österreichischen Verfassung. 1919 wurde er von Staatskanzler Karl Renner damit beauftragt, ein Österreichisches Bundesverfassungsgesetz mit zu gestalten. Bis 1930 war er als parteiunabhängiger Experte ein Mitglied des Verfassungsgerichtshofes. Mit der Machtübernahme des Ständestaates und später der Nationalsozialisten verließ Hans Kelsen Österreich, dann Mitteleuropa und emigrierte in die USA. Sein zentrales Anliegen war die Verteidigung der Freiheit gegen jede Form der Unterdrückung. Das Instrument, die Freiheit und damit eine demokratische Verfassung zu verteidigen, war für Hans Kelsen das Recht: objektiv, vernünftig, jenseits ideologischer Prägung.
Oberstes Gebot: Die Einhaltung der Menschenrechte
Reicht das Einhalten von Regeln aus, um Unrecht zu verhindern? Oder kann Recht zu Unrecht werden, wenn sich die Intension, das Ziel, wofür die Rechtsordnung gebraucht wird, verändert?
Der Rechtsphilosoph Gustav Radbruch, der 1921 bis 1923 Reichsjustizminister in der Weimarer Republik war, erkannte das Dilemma. Denn Radbruch hatte unter dem nationalsozialistischen Terrorregime erlebt, wie Recht zu Unrecht wurde.
Darf der Einzelne seine Verantwortung an den Rechtsstaat delegieren? Was tun, wenn ein Gesetz den Grund- und Menschenrechten widerspricht? Gustav Radbruch beantwortete die Frage, in dem er den Richtern riet, Gesetze die gegen die Menschenrechte verstoßen, nicht anzuwenden.
Radiokolleg zum Mitreden
Wenn Sie über das Thema der Serie "Recht oder Unrecht" mitdiskutieren möchten, dann haben am 25. März dazu Gelegenheit: Live beim "Radiokolleg zum Mitreden", ab 19:30 Uhr im ORF Kulturcafé. Margarethe Engelhardt - Krajanek, die Gestalterin dieser Reihe, wird moderieren.
Oder sie diskutieren über Twitter: der Hashtag lautet: #rkmitreden. Der Livestream aus dem RadioKulturhaus ist am 25. März 2010 ab 19:30 Uhr aktiv.
Mehr zum Thema "Recht und Unrecht" in oe1.ORF.at
Recht und Politik
Hör-Tipp
Radiokolleg, Montag, 22. März bis Donnerstag, 25. März 2010, 9:05 Uhr
Link
Radiokolleg auf Twitter