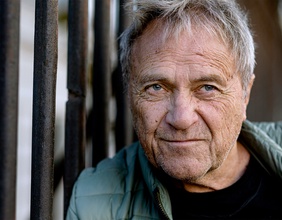Diagonal, Samstag, 17:05 Uhr
50 Stunden-Woche
29. September 2010, 00:35
Immer mehr Arbeit für immer weniger Leute?
Immer mehr Arbeit für immer weniger Leute? Sind wir schon auf dem Weg zum "working poor"? Was in Amerika mittlerweile gang und gäbe ist, scheint sich auch in Österreich breit zu machen. So genannte "prekäre" Arbeitsverhältnisse am Rande der Legalität betreffen mittlerweile jeden dritten Arbeitnehmer.
Im Bilderbuch ist es so: Wer Arbeit hat, der hat ein fixes Einkommen, dafür zahlt er Steuer und Sozialabgaben, dafür geht er pro Woche 38 bis 40 Stunden arbeiten, er hat Anrecht auf ein 13. und 14. Monatsgehalt, auf Urlaub, auf Kranksein, später einmal auf eine Pension und wenn man ihn feuert, auf Arbeitslosengeld. Dazu behütet ihn ein dichtes Geflecht aus arbeits- und sozialrechtlichen Schutzbestimmungen, Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen. So sieht es im Bilderbuch des Wohlfahrtsstaates aus.
Von wegen frei!
In der Realität des so genannten Wohlfahrtsstaates hingegen arbeitet ein Drittel der Beschäftigten in Arbeitsverhältnissen, die als "prekär" bezeichnet werden. Prekär definiert der Fremdsprachen-Duden als "misslich, schwierig". Ein Drittel der Beschäftigten also arbeitet in Verhältnissen, die auch als "atypisch", also untypisch bezeichnet werden.
Was da untypisch ist, wenn es jeden dritten Beschäftigten betrifft, ist schwer einzusehen. So genannte atypische Beschäftigungsverhältnisse haben viele Namen: Teilzeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung, befristetes Dienstverhältnis, neue Selbständigkeit, Werkverträge, freie Dienstverträge, Heimarbeit, Telearbeit, Leiharbeit, Zeitarbeit. Das klingt ja zum Teil toll. Nicht mehr diese ewige Abhängigkeit, sondern: Freie Dienstverträge! Neue Selbständigkeit!
Neuer Name - alter Job
"Eine Putzfrau kann z.B. als neue Selbständige geführt werden, das ist auch oft der Fall", sagt Josef Wallner von der Arbeiterkammer. Na gut, das klingt nicht so toll. Da müsste sich die Marketingabteilung der Reinigungsbranche noch was Flotteres einfallen lassen für den Begriff Putzfrau. Andere Branchen gehen da längst mit besserem Beispiel voran:
"Die schlechtesten Jobs sind Sampling", erzählt Matthias, 24 Jahre alt. "Das bedeutet, dass man auf der Straße steht und für den Kunden Produkte, Zettel, oder was auch immer er an den Kunden bringt."
Früher nannte man das "Zettelverteiler", aber die Promotion-Branche, die schaut auf ein gehobenes Niveau und sagt dazu Sampling.
Abwechslungsreich, aber ungewiss
Matthias arbeitet seit vier Jahren ausschließlich in prekären, also atypischen Arbeitsverhältnissen. Notfalls auch als Zettelverteiler. Pardon: als Sampler. Im so genannten Promotion-Bereich. Also für Agenturen, die Direktwerbung machen, Werbung, mit der sie direkt an den Endverbraucher herankommen. Das reicht vom Zettelverteilen über das Anbieten eines neuen Streichkäses in Fußgängerzonen bis zur Roadshow, in der neue Mobiltelefone oder Geländewagen vorgeführt werden.
Und dabei fühlt Matthias sich nicht einmal unwohl. Er hat ein eigenes Auto, wenn er das beruflich einsetzt, erhält er leichter Aufträge. Er schätzt durchaus, dass die Arbeit abwechslungsreich ist, der Arbeitsort wechselt, dass er immer mit neuen Leuten und anderen Produkten zu tun hat. Auch wenn man nicht immer weiß, wie viel man im nächsten Monat verdienen wird.
"Dann schaut man halt durch die Finger"
"Prinzipiell ist es so, dass man mehr oder weniger das letzte Glied ist." Wird das wenigstens durch eindrucksvolle Honorare abgegolten?
"Wenn man sagt, man verdient jetzt z.B. 10 Euro die Stunde, klingt das ja sehr gut, nett und schön", erzählt Matthias. "Es ist aber eben nur eine Zeitarbeit, die sich nur auf bestimmte Tage aufteilt."
Und wie kommt man überhaupt an die Aufträge? "Man wird angerufen und bekommt gesagt, es gibt in dem und dem Zeitraum für die und die Zeit das und das zu tun", erzählt Matthias. "Wenn dann der Auftraggeber das Ganze abbläst und man rechnet damit, dann schaut man halt durch die Finger", erzählt Matthias.
So viel Finger hat man gar nicht, wie man bei prekären Beschäftigungsverhältnissen zum Durchschauen braucht, wenn nur ein bisschen was schief geht.
"Das ist der Nachteil an diesem ganzen Job, wenn man krank ist, wenn man aus irgendwelchen bestimmten Gründen nicht arbeiten kann, wird man nie Geld dafür sehen. Wenn man krank ist, ist man krank."
Selbst versichern schwer gemacht
Hier muss man differenzieren. Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind derart atypisch, dass man nicht in allen Fällen gar nicht versichert ist: Es gibt Arbeitsverhältnisse, da wird man voll angemeldet, es gibt Arbeitsverhältnisse, da darf man nur bis zur Geringfügigkeitsgrenze verdienen, damit man nicht angemeldet sein muss. "Und prinzipiell ist es so, dass man sich selber versichern muss. Sollte", ergänzt Matthias.
Sollte. Denn wie könnte man sich wohl selbst krankenversichern mit 316 Euro Einkommen, also unter der Geringfügigkeitsgrenze. Weit über 200.000 Menschen verdienen weniger als 316 Euro. Und wovon sollte man sich wohl pensionsversichern selbst mit zwei geringfügigen Einkommen aus zwei parallelen Monatsjobs.
Kuriose Diskussion um Pensionen
Für fast ein Drittel der österreichischen Beschäftigten, also für jene mit atypischen Beschäftigungen, von denen viele noch nie oder schon lange nichts mehr in eine Pensionsversicherung eingezahlt haben, muss die ganze Diskussion um die österreichischen Pensionen - 45 Beitragsjahre sind genug oder doch nicht - als abgehobene Groteske erscheinen, als ein absurdes Ding vom Mars, mit dem sie nichts zu tun haben, und, wenn es mit ihrer Arbeit so oder schlechter weitergeht, mit dem sie nie zu tun haben werden, weil sie einfach gar keine Beitragsjahre für irgendeine Pension zustande bringen können.
Doch was soll's. Die "neue Selbständigkeit" ist so neu ja gar nicht: Seit je war sie selbstverständlich für Zeitungskolporteure und Künstler, für Putzfrauen und Journalisten, für Taglöhner oder nicht angemeldete Bauarbeiter.
Lauter Ein-Mann-Betriebe
"Eine neue Qualität ist auf jeden Fall, dass die Zahl dieser Verträge explodiert ist", sagt Josef Wallner, Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt in der Wiener Arbeiterkammer. In den letzten sechs Jahren hat sich die Zahl der so genannten freien Dienstverträge fast verdreifacht. Auch die Zahl der Betriebe ist deutlich angestiegen - lauter Ein-Mann-Betriebe, lauter neue Selbständige, oft genug Schein-Selbständige, die in Wahrheit von einer einzigen Firma abhängig sind.
Und das funktioniert so, "dass viele Menschen, die eigentlich unter ganz normalen Vertragsbedingungen arbeiten sollten als Angestellte, als Arbeiter, jetzt einfach einen so genannten Werkvertrag kriegen, wo der Auftraggeber dann sagt, du bist nicht mein Angestellter, du bist quasi nur mein Vertragspartner. Ich kaufe die Dienstleistung von dir zu, wenn die Arbeit nicht fertig ist, dann zahlst du womöglich auch noch ein Pönale", erklärt Josef Wallner.
Geänderte Macht- und Marktverhältnisse
Und woran liegt das nun, dass die neuen Tagelöhner so überhand nehmen? Jahrzehntelang haben sich Organisationen der Arbeiterbewegung wie Gewerkschaften um arbeits- und sozialrechtlichen Schutz bemüht. Waren das nur zahnlose Schönwettergesetze, die sie durchgesetzt haben?
"Wir haben einfach Rekordarbeitslosigkeit", lautet Wallners Begründung. "Das zwingt immer mehr Menschen dazu, einfach die Vorgaben der Unternehmer anzunehmen, ob sie das wollen oder nicht." Unter Umgehung bestehender Gesetze? "Das ist noch im Bereich des Legalen, es zeigt nur, dass sich die Machtverhältnisse, die Marktverhältnisse zu Lasten der Arbeitnehmer verändert haben."
Bedrohter Wohlfahrtsstaat
Aber es geht nicht nur zu Lasten der prekären Arbeitnehmer. Atypisch Beschäftigte zahlen gar nichts oder nur sehr wenig in die Kranken- und Pensionsversicherung, gar nichts in die Arbeitslosenkasse, wenig oder gar nichts an die Finanzämter.
Der Wohlfahrtsstaat als solcher ist bedroht, wenn diese atypischen Formen zur Normalität werden, weil es natürlich auf der Beitragsseite und auf der Einnahmenseite massive Ausfälle gibt, die nicht kompensiert werden können.
Buchtipps:
Manfred Füllsack: "Leben ohne zu arbeiten - zur Sozialtheorie des Grundeinkommens", Avinus Verlag
Maria Wölflingseder/Karl Heinz Lewed: "Dead Men Working", Unrast Verlag Münster
Richard Sennett, "Der flexible Mensch", Siedler Taschenbuch
Christa Stippinger: "Arbeit ist Arbeit", Edition Exil
Jürgen Kocka/Claus Offe: "Geschichte und Zukunft der Arbeit", Campus Verlag
Ulrich Beck: "Die Zukunft von Arbeit und Demokratie", Suhrkamp Verlag
Kontakte
Beratungsstelle für atypisch Beschäftigte: Jugendinitiative LIDO
"Links der Donau"
1220 Wien, Hischstettner Straße 19-21, Tel.: ++43 1/256 24 28
MATADITA
1100 Wien, Triester Straße 114/2, Tel.: ++43 1/665 09 19
Links
WUK Werkstätten und Kulturhaus