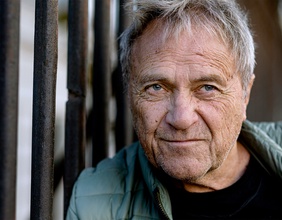Diagonal, Samstag, 17:05 Uhr
Zum Thema: Hören
29. September 2010, 00:35
Drei Millionen Jahre homo audiens
Der Bereich der Sinneswahrnehmung Hören umfasst nahezu alle Felder des täglichen Lebens. Hören ist - neben dem Lesen und dem Sprechen - die tragende Kulturform unserer Gesellschaft.
Zwei Parameter bestimmen den Klang eines Raumes: seine - vor allem bauliche - Ausgestaltung und die Art der darin stattfindenden Lautereignisse. Beides änderte sich in der europäischen Großstadt seit Mitte des 19. Jahrhunderts grundlegend.
Die im Gefolge der Industrialisierung rapide wachsenden Städte begannen sich - visuell und akustisch deutlich wahrnehmbar - in ihr Umfeld auszubreiten. Dies ging einher mit einer sukzessiven Versiegelung des Untergrundes und dem Anwachsen der geschlossenen Verbauung - in der Horizontalen wie in der Vertikalen. Raumakustisch völlig neue, steinerne Stadtlandschaften entstanden, mit zum Zentrum hin immer tiefer werdenden "Straßenschluchten", in denen sich der Schall vielfach reflektierte.
Ein relativ hoher Grundgeräuschpegel und ein Verlust an akustischer Orientierung waren die Folgen, beides Wahrnehmungen, die bereits von den Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts gemacht wurden. So sprach etwa die weit gereiste Schriftstellerin und Journalistin Emmy von Dincklage von einem schwer entrinnbaren Gefängnis, das mittlerweile jede große Stadt in akustischer Hinsicht darstelle.
Pferde, Tramway, Automobile
Wenngleich auch die vorindustrielle Stadt ein Hort von Hektik und Betriebsamkeit, lauten Menschenansammlungen, lärmenden Handwerksbetrieben und alles andere als ruhigen Verkehrsgeräuschen gewesen war, so erlangte der Stadtlärm doch nunmehr eine neue Dimension und Qualität. Dabei war es vor allen die enorme Intensivierung des Verkehrs, die sich akustisch am eindrucksvollsten bemerkbar machte. Unzählige Pferde, mit und ohne Wägen, Pferde- und Dampftramway sowie später die elektrische Tramway, Stadtbahnen, Automobile, Motorräder und Fahrräder: Sie alle brachten ihre Spezifika ein in den immer vielstimmiger werdenden Chor der Verkehrsgeräusche.
In zunehmendem Maße wurden die von Mensch und Tier verursachten Laute von Maschinengeräuschen verdrängt. Diese waren es auch, die zum hörbaren Erkennungszeichen der Großstadt werden sollten, zur sinnlich wahrnehmbaren Signifikanz der Moderne.
Überhörte Warnrufe
Deutlich wahrnehmbar kam es zu einer Erhöhung des Geräuschpegels. Dies lässt sich beispielhaft anhand jener Signaltöne nachvollziehen, die eingesetzt wurden, um vor Gefahren zu warnen. So wurde etwa in Wien der Ausbruch eines Brandes seit dem 16. Jahrhundert durch einen Wächter im Stephansturm kundgetan, der aus voller Kehle und verstärkt durch ein Sprachrohr "Feuer!!!" brüllte.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts hob sich dieses Signal nicht mehr deutlich genug ab vom übrigen akustischen Milieu im Herzen der Stadt, sodass man es 1855 durch eine direkte telegrafische Verbindung zur zentralen Löschanstalt am Hof ersetzte. Auch die Einsatzfahrzeuge mussten sukzessive ihre Signalstärken erhöhen. Die bislang üblichen Trompeten- und Glockensignale wurden allmählich vom jaulenden Klang der Sirene abgelöst.
Das "Recht auf Stille"
Die Stadt war "groß und laut" geworden, das stellten so manche Zeitgenossen bedauernd fest. Und immer häufiger tauchten auch Klagen über den Verlust an Stille auf. Mit dem Ausbau der öffentlichen Beleuchtung drang die Stadtgesellschaft mit ihren Aktivitäten immer weiter in die Nacht hinein vor. Die Schlaflosigkeit der großen Stadt, ihr kontinuierlicher Betrieb, wurde zum Charakteristikum der Metropolen. Immer mehr verschwammen die akustischen Kontraste zwischen Tag und Nacht; immer kürzer wurden die Phasen der Stille.
Nicht zufällig proklamierte der Wiener Burgtheaterdirektor Freiherr von Berger bereits 1909 das "Recht auf Stille", das es wieder durchzusetzen gelte. Eine richtige Stille, meinte er, sei mittlerweile so gut wie unbekannt, ja der Großstädter brauche oft sogar einen gewissen Geräuschpegel, um sich wohl zu fühlen.
Tonlawine
In bürgerlichen Aufzeichnungen tauchen immer öfter Klagen über die gestiegene Lautstärke in den Städten auf. In Berlin konstatierte Stadtbaumeister Pinkenburg, dass man im Getöse der Hauptverkehrsstraßen oft nicht einmal mehr sein eigenes Wort verstünde; Ohrenärzte beschwerten sich darüber, dass es in ihren Praxen mittlerweile viel zu laut sei, um ordentliche Hörprüfungen durchführen zu können; und in London, der zur Jahrhundertwende mit 7 Mio. Einwohnern größten Stadt Europas, monierte man, dass der Verkehrslärm gar die Dinnerkonversation verunmögliche.
Der englische Architekt Creswell schreibt in seinen Erinnerungen: "Der Krach überstieg alle Vorstellungen. Das Donnern von Unmassen eisenbeschlagener Hufe auf dem Kopfsteinpflaster aus Granit, das ohrenbetäubende Getrommel von Wagenrädern, die von einem Pflasterstein zum nächsten hüpften wie Stöcke entlang eines Zauns, das Quietschen, Knarren, Klappern und Kreischen der Fahrzeuge selbst, das Rasseln der Pferdegeschirre und das Klirren und Schallen von wer weiß was sonst, verstärkt durch Geschrei und Gebell, vereinigte sich zu einem Höllenlärm, der jede Vorstellung übersteigt. Es hatte mit so etwas Schäbigem wie 'Geräusch' nichts mehr gemein: Es war eine Tonlawine."
Gründung eines Antilärmvereins
Als Reaktion darauf entstanden erstmals in Europa gesellschaftliche Bewegungen, die sich dem Kampf gegen den Lärm verschrieben. In Deutschland veröffentlichte der renommierte Kulturphilosoph Theodor Lessing 1908 ein Buch mit dem provokanten Titel "Der Lärm. Eine Kampfschrift gegen die Geräusche unseres Lebens", und noch im selben Jahr gründete er in Hannover einen "Antilärmverein".
Doch trotz der vielen Sympathiekundgebungen und der hohen medialen Resonanz, die der Verein auch in Österreich erlangt hatte, musste er schon nach wenigen Jahren seine Tätigkeit einstellen. Notorische Geldnot und die zu geringe Anzahl an aktiven Mitgliedern, die fast durchwegs aus bürgerlich-liberalen Kreisen stammten, waren die unmittelbaren Gründe dafür. Dessen ungeachtet sollte das Ausmaß des Lärms fortan eine zentrale Rolle im Diskurs über Wert und Unwert der modernen Großstadt spielen.
Text: Peter Payer, Historiker, arbeitet derzeit an einem Buch mit dem Titel "Die Stadt und der Lärm"