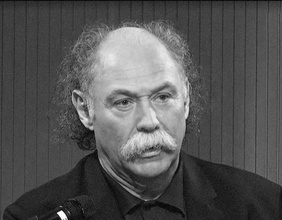Ö1 Symposion: Creative Cities
2009, das EU-Jahr der "Kreativität und Innovation", war Anlass, den Bedeutungswandel schöpferischen Denkens und Handelns zu thematisieren. Im Zentrum stand das Spannungsfeld von Creative Industries und Kunst.
21. August 2018, 21:46
Flexibel und selbstbestimmt werken Menschen in kreativen Berufen rund um die Uhr, mit viel Enthusiasmus, oft ohne soziale Sicherheit. Statt fremdbestimmter Lohnarbeit ist Selbstverwirklichung angesagt. Wo sich "kreative Cluster" bilden, florieren Bars, Boutiquen und Galerien. Die Stadt wird zur Spielwiese für die "kreative Klasse" und das Image der kreativen Ökonomie zur positiven Utopie. Der "Künstler-Unternehmer" oder der "Unternehmens-Künstler" gilt in Zeiten der Krise als Idealtypus. Doch wie viel haben Kunst und Unternehmertum wirklich gemeinsam? Wie vertragen sich künstlerische Gesellschaftskritik und wirtschaftliches Gewinnstreben?
2009 ist das "Jahr der Kreativität und Innovation" und die Europäische Union hat sich "Die Förderung der Kreativität für alle" auf ihre Fahnen geschrieben. Mit dem Ende des Industriezeitalters werden die "Creative Industries" von Regierungen weltweit als wirtschaftliches Hoffnungsgebiet beschworen. Kreativität wird dabei als unerschöpfliche Ressource, gar als "Öl des 21. Jahrhunderts" mystifiziert. Arbeitsplätze - so wird suggeriert - schafft man sich selbst, im Home Office, im virtuellen Netzwerk. Befristete "Projekte" ersetzen immer öfter den Job auf Lebenszeit. Lebenslanges Lernen soll die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Doch von der Wertschöpfung der "Ideenwirtschaft" profitieren nur ganz wenige, meist große Unternehmen der Kulturindustrie. Das durchschnittliche Einkommen der "cultural workers" ist sehr gering. Entsteht damit ein neues intellektuelles Proletariat, eine Art Tagelöhnertum im Zeitalter von Web 2.0., selbständig aber doch nicht frei?
Was macht diesen Lebensentwurf dennoch attraktiv? Ist es die Vorstellung aus dem Hobby einen Beruf zu machen? Ist es die Hoffnung auf Star-Ruhm? Oder einfach der Mangel an Alternativen? Muss nun "jeder ein Künstler" werden, frei nach Joseph Beuys? Oder müssen alle Künstler/innen ins Betriebswirtschaftsseminar? Und ist nicht der Zwang zur ökonomischen Verwertbarkeit für das kreative Schaffen letztlich kontraproduktiv? Lässt sich Innovation auf Knopfdruck herstellen? Vor welchen Herausforderungen stehen Kunstförderung und Aus- und Weiterbildungsinstitutionen?
Text: Ina Zwerger und Armin Medosch
Mehr zu Creative Cities in oe1.ORF.at
Kreative Ökonomie
Der Wandel des Begriffes Arbeit
Vom Aufstieg der kreativen Klasse
Neustart statt Depression
Das Versprechen der "kreativen Ökonomie"
Eine Veranstaltung der Ö1 Wissenschaftsredaktion in Kooperation mit dem BMUKK, Departure und WWTF.
Ö1 Symposion: Creative Cities. Das Versprechen der kreativen Ökonomie
Dienstag, 31. März 2009
14:00 Uhr
Großer Sendesaal
Ablauf
"Creative Labour & Proletarian Playtime in the European City"
Mit: Richard Barbrook, Westminster University, London
"Kunstarbeit - eine pragmatische Analyse"
Mit: Diedrich Diederichsen, Kulturwissenschaftler, Berlin/Wien
Publikumsgespräch und Pause
"Freie Kultur und die Folgen der kreativen Politik - Am Beispiel der Niederlande"
Mit: Geert Lovink, Institute of Network Culture, Amsterdam
"Vom Kruppstahl zu den Creative Industries - Am Beispiel Dortmund"
Inke Arns, HMKV, Hartware Medienkunst, Dortmund
Publikumsgespräch
"Images of Economy: Kulturproduzent/innen und geistiges Eigentum"
Mit: Jaime Stapleton, Associate Research Fellow, Birkbeck, University of London
Pause und Performance
Künstlerische Interventionen: Marlies Pöschl /cre-activity check; Djana Covic & Fahim Amir / from live models
"Wirtschaftliche und subjektive Verarmung im Neoliberalismus. Eine Kritik der Creative Industries"
Mit: Maurizio Lazzarato, Soziologe und Philosoph, Paris
Übersetzung: Stefan Nowotny
Diskussion: "Vom Versprechen der kreativen Ökonomie: Fantasma oder Paradigmenwechsel?"
Mit Andreas Spiegl (Vizerektor der Akademie der Bildenden Künste), Monika Mokre (Politikwissenschaftlerin - FOKUS), Christoph Thun-Hohenstein (Geschäftsführer von departure), Stefan Leitner-Sidl (Gründer der Schraubenfabrik), Walter Gröbchen (Labelbetreiber) und Marion von Osten (Künstlerin).
Moderation: Ina Zwerger und Armin Medosch
Übersicht
- Gespräche