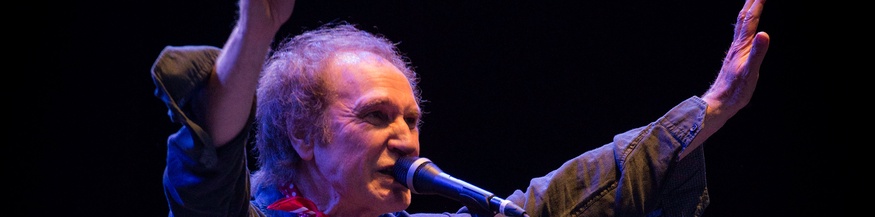Burnout und Eislaufmütter
Wenn Musik krank macht
Musik kann krank machen, meint der Musikpsychologe Rainer Holzinger. Gerade wenn man sie besonders liebt und zum Beruf wählt. Doch auch manch ehrgeizigen Eltern können ihren Zöglingen die Freude an der Musik so richtig austreiben.
8. April 2017, 21:58
Stressfaktor Musik
Rainer Holzinger hat seine berufliche Laufbahn als Flötist begonnen, stand als Solist vor großen Orchestern auf der Bühne und wurde dann Musikpsychologe. Heute hat er eine Praxis in Linz und lehrt auch an der dortigen Anton-Bruckner-Privatuniversität. Seine Klienten sind Menschen im Höchstleitungsbereich, die gecoacht oder therapiert werden, oftmals mit Musik.
Durch seine Doppelkompetenz ist Rainer Holzinger häufig mit Profimusikern beschäftigt, die über Angst, Stress oder Burnout klagen; oder es besuchen ihn die so genannten Eislaufmütter (die zuweilen natürlich auch Eislaufväter sind), die ihr Kind gleich einmal mit Sätzen wie: "das ist der künftige Dirigent" vorstellen. Die Kinder bringen nicht mehr die Leistung, die sich die ehrgeizigen Eltern von ihnen wünschen und der Musikpsychologe "soll's jetzt richten ...".
Zuwendung und Leistung
Rainer Holzinger unterstützt in solchen Fällen natürlich nicht den Ehrgeiz der Eltern, sondern betont, dass die Zuwendung der Eltern nicht von der Leistung des Kindes abhängig gemacht werden darf. Hat das Kind das Gefühl, ich werde geliebt, auch wenn ich nicht die erwartete Leistung bringe, dann ist es auch zu Höchstleistungen fähig.
Holzinger betont, dass er nicht die Leistungsanforderung oder den Perfektionismus in jedem Fall reduzieren will. Das gilt für Erwachsene wie Kinder. Ist die Begabung da, dann sind Höchstleistung und Perfektion nichts Schädliches - für Kinder aber dann möglicherweise ein Drama, wenn die Zuwendung der Eltern davon abhängt.
Aversion gegen Musik
Umfragen belegen, dass viele Menschen, die in ihrer Jugend mit der so genannten klassischen Musik in Berührung kommen, in diesem Bereich gefördert und unterrichtet werden, später diese Musik ablehnen. Warum das? Holzinger ist der Meinung, dass der Grund in der Art der Vermittlung liegen kann, die oftmals von der Art "A-Dur hat drei Kreuze" sei. Man lehrt den Quintenzirkel, sorgt aber nicht für einen emotionalen Zugang zur Musik.
So kommt es zu einer "klassischen Kopplung" und zur "Aversion". Hört der Mensch später die so vermittelte klassische Musik, koppelt er diesen Eindruck mit der "Quintenzirkel-Erfahrung" und beginnt negativ zu reagieren.
Leistung durch Nachahmung
Ein Zugang zur Musik über Vorbilder (der angehimmelte Maestro, die geliebte Klavierlehrerin) sei nichts schlechtes, ja der beste Weg gar zur Motivation. Allerdings dürfe auch hier die Musik nicht als Mittel zum Zweck der Zuwendung von der geliebten Person missbraucht werden.
Es ginge um die Differenzierung: Einerseits Leistung durch Nachahmung, aber andererseits die Sicherheit: "Ich bin als Mensch noch ok, auch wenn ich die Fortschritte am Instrument nicht mache. So lange das gewährleistet ist, habe ich als Psychologe kein Problem."
Kann Musik krank machen?
Sie kann, meint Rainer Holzinger im Studiogespräch für "Apropos Musik. Das Magazin". Gerade wenn man sie besonders liebt und zum Beruf wählt. Profi-Musiker stehen sich oft selbst im Weg: weil sie unter Ängsten leiden oder zu hohe Ansprüche an sich selbst haben oder auch weil sie mit der Gruppendynamik eines Orchesters nicht umgehen können.
Er versuche den Musiker und Musikerinnen dann zu vermitteln, sich nicht zu wichtig zu nehmen, sich wieder in den Dienst der Sache zu stellen, "hinter die Musik zurückzutreten". Vor dem Konzert ganz dem Perfektionismus frönen, aber dann auf der Bühne der Musik dienen. Auf die Frage, wie das denn möglich sein soll, sich einerseits als Star präsentieren und perfektionistischen Ehrgeiz entwickeln, andererseits dann plötzlich hinter die Musik zurücktreten, meint Holzinger: "Mehr denn je werden von den Menschen unterschiedliche Rollen abverlangt. Wir sind ständig darauf bedacht, gewisse Rollen zu perfektionieren. Darin liegt auch mein Ansatz in der Therapie oder im Coaching mit Musikern - sie nämlich darauf vorzubereiten, dass sie unterschiedliche Rollen leben müssen."
In der Entwicklung eines Musikers sei es ganz entscheidend, einen Teil seiner Persönlichkeit zu professionalisieren und perfektionieren (nämlich den als Musiker), ohne aber die anderen Teile zu vergessen. "Ich versuche dann den Menschen 'aufzumachen', zu zeigen, was er noch außer dem Instrument kann."
Service
Rainer Holzinger, "Diagnose: Auftrittsangst. Das Phänomen im Fokus der analytischen Triade Körper, Geist & Seele", Weinberg: Verlag Studio Weinberg
Christian Frauscher und Rainer Holzinger, "Mentales Training im Instrumentalspiel", Weinberg: Verlag Studio Weinberg
Rainer Holzinger, "Von der unsicheren (Pseudo-)Sicherheit zur sicheren Unsicherheit. Elaborierte Beschreibung einer ambulanten verhaltenstherapeutischen Einzelbehandlung eines Geigers mit der Diagnose Zwangsstörung", Weinberg: Verlag Studio Weinberg
Rainer Holzinger, "Kognitive Verhaltenstherapie & Auftrittsangst", Weinberg: Verlag Studio Weinberg
Kontakt:
E-Mail - Verlag Studio Weinberg