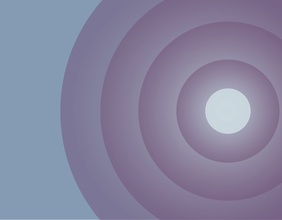Gordon Browns Traum einer Weltwirtschaftsregierung
Was folgt
Er mag die britischen Banken gerettet haben, doch politisch genützt hat es ihm nichts: Bei den Wahlen 2010 gingen Gordon Brown und Labour unter. In seinem neuen Buch schildert Brown, wie er Großbritannien durch die Turbulenzen steuerte und welche Gefahren weiterhin lauern.
8. April 2017, 21:58
Ernüchterung folgte der Euphorie
Gordon Brown war der glückloseste Premierminister Großbritanniens seit 1945. Der blasse John Major konnte sich immerhin sieben Jahre im Amt halten und Margaret Thatchers politisches Erbe scheibchenweise verspielen, ehe er bei den Wahlen von 1997 vom damals jungen und rhetorisch brillanten Tony Blair vernichtend geschlagen wurde.
Blairs New Labour-Politik führte zu einem europaweit spürbaren Aufschwung der Sozialdemokratie, dem zehn Jahre später allerdings die Ernüchterung folgte. Tony Blair, stellte sich heraus, war einfach nur netter als Margaret Thatcher. Es änderte sich aber nichts am Privatisierungsprogramm, allen schlechten Erfahrungen zum Trotz; es erfolgten weiterhin massive Kürzungen bei den Sozial- und Gesundheitsausgaben - und es wurde auch die an die USA gekoppelte aggressive Außenpolitik weitergeführt, die 2003 etwa zum Irakkrieg führte.
Auf verlorenem Posten
Je mehr Tony Blair an Glanz verlor, umso stärker profilierte sich Finanzminister Gordon Brown als innerparteilicher Kritiker. Mitte der 1990er war klar: Brown strebt einen Führungswechsel an, möglicherweise um Labour noch zu retten. Doch als er 2007 schließlich Premierminister wurde, war da nichts mehr gut zu machen. Jedenfalls nicht von Brown, dem wenig charismatischen, etwas träge wirkenden Technokraten, der wirkte, als versuche er, in einem zu Schrott gefahrenen Auto den vierten Gang zu finden.
Gordon Brown hob nicht ab, wie man im Beraterjargon sagt - doch plötzlich, im Herbst 2008, bot sich ihm die Chance, die sein politisches Überleben - vielleicht - sichern konnte: Die Bankenkrise, die sich zur wirtschaftlichen Katastrophe auszuwachsen drohte. Das gesamte Bankenwesen stand vor dem Kollaps, die Europäer waren schreckensstarr und bewährt entscheidungsschwach. Die Amerikaner scheiterten unterdessen mit dem Versuch, staatliche Hilfe zu leisten und zugleich den Staat aus dem Spiel zu lassen, um den Glauben an selbstregulierende Märkte nicht in Frage zu stellen.
"We not only saved the world ..."
Ausschnitt aus einer Unterhausdebatte, in der Gordon Brown dem damaligen Oppositionsführer und nunmehrigen Premierminister David Cameron sozusagen den Elfmeter auflegt.
Tabubruch mit Folgen
Schon lange habe ich den Eindruck, dass der Rhythmus des politischen Alltags allzu oft auf Symptome, nicht auf Ursachen gerichtet ist; auf Reaktion, nicht auf Reflexion; auf die niedrig hängenden, nicht auf die hoch hängenden Früchte. Es gibt Zeiten, in denen Entscheidungen unter Hochdruck zu fällen sind, und selbst wenn wir wissen, was richtig ist, schaffen wir Politiker es allzu oft nicht, zu handeln. Aber in diesem Fall haben wir schnell gehandelt und das Problem im Kern angepackt.
Gordon Brown, und davon handelt sein Buch, wagte den Tabubruch. Er verordnete den maroden britischen Banken Finanzspritzen aus öffentlichen Geldern, das heißt er verstaatlichte die Institute. Und das mit vielerlei Auflagen: die Frage der Boni wurde neu verhandelt, es wurden ethische Grundsätze erlassen und vor allem sollte das investierte Geld nach der Konsolidierung in die Staatskassa zurückfließen. Er spekulierte mit einer Win-win-Situation.
Dass der britische Premierminister solche Entscheidungen am Parlament vorbei treffen kann, war dem Rettungsplan dienlich. Dass die skeptischen Europäer, die dann auch noch ihre skeptischen Parlamentarier überzeugen mussten, mitzogen und schließlich die Amerikaner auf seinen Kurs einschwenkten, war ein Glück für Brown. Großbritannien allein hätte gar nichts bewirkt.
So weit, so spannend. Nur nicht aus Gordon Browns Feder. Politisch, muss man anmerken, hat ihm sein Bankenrettungsprogramm nichts genützt, schon bei den darauf folgenden Wahlen 2010 gingen er und Labour unter.
Späte Anerkennung?
Gordon Browns Buch nun liest sich wie der Versuch, sich die Anerkennung, die ihm als Premierminister nicht zuteilwurde, eben selbst auszusprechen. Das Problem dabei ist: man merkt ihm den Versuch der Selbstadelung auf jeder Buchseite an. Damit das Eigenlob nicht gar so verzweifelt herbei geschrieben werden muss, bevölkern Scharen von besonnenen, klugen, humorvollen, fleißigen und umsichtigen Staatsführern und Spitzenbeamten den Kosmos jenes Mannes, der am Ende doch ganz allein entscheiden muss, ob die Welt im Elend versinkt oder nicht.
Hier wird mit niemandem abgerechnet, sieht man einmal von der Tatsache ab, dass der Name Tony Blair im ganzen Buch nur zweimal vorkommt. Das mag im Prinzip löblich sein, doch Gordon Brown scheint, so der Eindruck beim Lesen, ein anderes Ziel zu verfolgen: sowohl die Politik als auch die freie Marktwirtschaft außer Diskussion zu stellen und so die Notwendigkeit einer Systemdebatte kleinzureden.
Die Weisheit der Regierenden
Brown gibt zwar zu, dass Märkte sich nicht zu jeder Zeit selbst regulieren und dass es, wie bei einem Krebsgeschwür im Organismus, zu einer plötzlichen und mitunter dramatischen Eigendynamik kommen kann. Er behauptet aber zugleich, dass das Feld der Politik ein Feld der wohlwollenden Heiler ist, denen wir uns getrost überantworten dürfen. Dabei unterscheidet er nicht zwischen den USA, China, Europa oder den afrikanischen Staaten. Wirtschaftswachstum, Wohlstand und Demokratie sind für ihn irgendwie verschmolzen, über Menschenrechte, Verteilungsungerechtigkeit und Umweltprobleme verliert er kein Wort, weil schließlich über allem die Weisheit der Regierenden steht.
"Wir müssen rasch zupacken, statt endlos zu diskutieren", schreibt Gordon Brown. Nun ja. Dass Brown bei seinem letzten großen Auftritt beim G-20-Gipfel im April 2009 von einer Weltwirtschaftsregierung träumte, also letztlich von einer Art Oligarchentum, in dem die wachstumsstärksten Industrie- und Schwellenländer das Sagen haben, weist darauf hin, dass der Mann entweder grenzenloses Vertrauen in die politische Klasse hat oder tatsächlich daran glaubt, dass nur ungehindertes Wirtschaftswachstum soziale Konflikte und Asymmetrien auszugleichen imstande ist.
Service
Gordon Brown, "Was folgt. Wie wir weltweit neues Wachstum schaffen", aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Bischoff und Petra Pyka, Campus Verlag
Campus Verlag - Was folgt