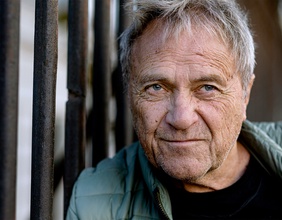9/11 als Medienspektakel
Das Bild ist die Botschaft
Am 11. September 2001 erlebte das Fernsehen Zyniker würden es so ausdrücken - seine letzte Sternstunde. Wohl seit der Übertragung der Mondlandung saßen weltweit nicht mehr so viele Menschen vor dem Fernsehapparat wie an diesem 11. September 2001. Das Fernsehpublikum hatte sich noch nicht in die Weiten des Internets verabschiedet. YouTube war noch nicht erfunden.
26. April 2017, 15:09
Kulturjournal, 07.09.2011
Wenige Minuten nachdem das erste Flugzeug um 8:46 Uhr New Yorker Ortszeit in den Nordturm des World Trade Center krachte, ist CNN live dabei. Noch glaubt man, es handle sich um einen Unfall. Eine Kamera fängt den brennenden Turm an der Südspitze der New Yorker Skyline ein. Ein Bild, das auch der ORF bereits ab 9:07 Uhr New Yorker Ortszeit, also 15:07 Uhr Wiener Ortszeit ausstrahlt.
Die brennenden Türme
Ein Sportflugzeug sei verunglückt, heißt es anfangs. Die Informationslage ist dünn. Nicht zuletzt deshalb lassen die Fernsehanstalten auf der ganzen Welt die Bilder für sich sprechen. Das Hölleninferno im Nordturm - aufgenommen aus immer neuen Perspektiven - flimmert als Dauerloop über die Fernsehbildschirme.
Die professionellen Bildermacher, die Reporter und Moderatoren werden von den Ereignissen überrollt. Hier führt jemand anderer Regie. Das wird spätestens klar, als das Fernsehpublikum live dabei ist, als die zweite Boeing in den Südturm des World Trade Center rast. Die Terroristen haben eine konzertierte Aktion geplant und spekulieren darauf, dass alle Kameras Manhattans zum Zeitpunkt der zweiten Kollision auf die Twin Towers gerichtet sind. Jetzt weiß die ganze Welt, dass es sich um keinen Unfall, sondern um einen Terroranschlag handelt.
Einen Terrorakt als konsumierbares Medienspektakel zu inszenieren, das war etwas völlig Neues, sagt der Marketingexperte Martin Andree, der sich in seinem Buch "Medien machen Marken" mit dem Medienphänomen 9/11 auseinandergesetzt hat:
"Wenn man Terrorismus als Verlängerung des Kriegs mit den radikalsten Mitteln auffasst, dann ist ja faszinierend, dass eigentlich Terrorismus vor 9/11 immer noch eine konkrete Dimension hatte. Egal, ob das Anschläge sind oder Geiselnahmen ging es immer darum, konkrete Ziele zu erreichen - in den meisten Fällen, das heißt, Geiseln werden typischerweise ausgetauscht zur Verwirklichung konkreter Ziele. Das ist natürlich auch eine ganz neue Dimension, weil eigentlich am 11. September an keinem Punkt Forderungen gestellt wurden, es gab keine konkret formulierten politischen Ziele. Das heißt, der Inhalt dieses Anschlags sind die Bilder, die dieser Anschlag in Umlauf gebracht hat."
Terrorismus als Symbolpolitik
Die Autorin Kathrin Röggla lebte im September 2001 nur wenige Blocks vom World Trade Center entfernt. "Ich wurde von einem Freund aus Deutschland angerufen und der hat gesagt, bei euch brennt es ja ums Eck", erinnert sie sich. "Da sind zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen und ich hab's nicht geglaubt und bin dann ans Fenster gegangen und hab dann leicht nach rechts geschaut und war ziemlich schockiert, als ich das gesehen hab."
Als Kathrin Röggla von den Anschlägen hörte, verlässt sie in einem ersten Impuls fluchtartig den Wolkenkratzer, in dem sie wohnt, und irrt orientierungslos durch die Straßen Lower Manhattans. Bald beginnt sie, wie viele Menschen an diesem Tag, die Ereignisse zu fotografieren.
"Diese verzweifelten Versuche der Menschen, dieses Geschehen festzuhalten, waren bemerkenswert", so Röggla. "Ich weiß noch, dass ich am nächsten Tag, am 12. September, in der Penn Station war, in einem riesigen Bahnhof, wo es viele Geschäfte gibt, in denen man auch Fotos entwickeln kann und da waren die Berge der Amateurfotos, die sich stapelten. Also, so viele Fotografien wie an dem 11. September wurden, glaube ich, selten in New York gemacht", erzählt Kathrin Röggla.
Die Erfüllungsgehilfen der Terroristen
Wer die Geschehnisse durch die Linse beobachtet, schafft Distanz. Es sei nicht blanke Sensationslust gewesen, die die Menschen zur Kamera greifen ließ, sagt Kathrin Röggla. Dennoch: An diesem 11. September 2001 machten sich alle Amateurfilmer und -fotografen genauso wie die professionellen Medienanstalten zu Erfüllungsgehilfen der Terroristen. Die Terroristen haben eines der einprägsamsten Bilder der Mediengeschichte geschaffen: das Bild der brennenden und einstürzenden Türme.
Es ist eine Heimsuchung filmischer Katastrophenszenarien, mit denen Hollywood lange vor 9/11 unsere Angstfantasien befriedigt hat. Vom Einbruch der Medienbilder ins Reale sprachen Großdenker wie Jean Baudrillard und Slavoij Zizek, von der perfekten Platzierung einer Botschaft spricht der Marketingexperte Martin Andree:
"Natürlich versucht man, ein besonders eingängiges Bild zu schaffen. Hier haben wir natürlich das Key Visual dieser zusammenstürzenden Türme. Genau das machen natürlich alle, die ihre kommunikativen Ziele erreichen wollen. Sie schauen sich an, wo es bereits Inhalte, wo es bereits Bildwelten gibt, die man ausschalten kann, ohne dass man sie neu etablieren muss. Deswegen ist es eigentlich eine parasitäre Bewegung, wenn ich hingehe und mir Vorbilder aneigne aus 'Independance Day' oder 'Armageddon' und so weiter. Eigentlich sind die Terroristen Parasiten von Hollywood und von Hollywood-Vermarktungsstrategien."
Dass sich ausgerechnet islamische Fundamentalisten, die die westliche Konsum- und Medienkultur zutiefst ablehnen, als ausgeklügelte Marketing- und Medienprofis erweisen, ist verstörend. Nur zwei Jahre, nachdem das Erfolgsformat "Big Brother" im niederländischen Fernsehen seine Weltpremiere feierte, machten die Dschihadisten vom 11. September die Weltöffentlichkeit zum unfreiwilligen Zeugen der grausigsten Reality-Show aller Zeiten.