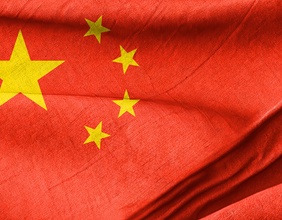Das Haus als unbewohnbares Statussymbol
Gastarbeiter in Pension
"Geh zum Schweden Gorbatschow", raten sie mir im kleinen Lokal am Dorfplatz von Duboka, als ich nach pensionierten Rückkehrern frage. Er gilt als reichster Mann im Dorf, denn er hat das größte Haus.
8. April 2017, 21:58
Man nennt ihn Gorbatschow, weil er dem Russen tatsächlich ähnlich sieht, überdies heißt er mit Vornamen Mihajlo, und "der Schwede" ist er, weil er in Schweden war, als Gastarbeiter in Stockholm.
Die Leute hier belächeln ihn ein wenig, weil er so gern jeden mit Stolz durch sein Haus führt. Aber sie mögen ihn auch, weil er sich, im Gegensatz zu anderen Rückkehrern, wieder integriert hat ins "Dorfleben" - selbst wenn das in einem Nest wie Duboka, wo 70, 80 Prozent der Leute im Ausland sind, nicht viel mehr heißt, als dass sich abends ein paar Männer auf dem staubigen Dorfplatz treffen. Im Lokal hängt eine Liste mit den Sponsoren des Fußballvereins; an erster Stelle: "Gorbatschow, 200 Euro."
"Zuerst Kaffee oder gleich das Haus?", fragt Stojana, Mihajlos Frau und legt schon die Schürze ab. Die Führung findet in Socken statt, denn es ist peinlichst sauber, die Böden glänzen, die Luster funkeln, die schweren Möbel sind, wie der Nippes, zentimetergenau platziert. Stojana geht voran, Mihajlo folgt und nennt die Preise des Inventars. Im dritten Stock liegen die Zimmer der Tochter, des Schwiegersohns, der beiden Enkel: Duftende Bettwäsche und frische Schnittblumen lassen vermuten, sie seien nur kurz weg und kämen gleich wieder. Aber wir haben Ende Juni. Erst im August werden sie, wie jedes Jahr, drei Wochen aus Stockholm zu Besuch kommen.
Das Haus in Zahlen: 9 Jahre Arbeit, knapp 500 Quadratmeter, 16 Zimmer, vier Bäder. Eine eingerichtete Küche fehlt, aber das macht nichts, denn die Gorbatschows wohnen nicht hier, sondern nebenan, im verbliebenen Teil ihres alten Bauernhofs, in der so genannten "Sommerküche": das ist Küche mit Holzherd und Sofa, dazu ein Zimmer und WC. Mehr brauchen sie nicht, und es lebt sich viel einfacher so.
In Ostserbien, im Dreiländereck mit Rumänien und Bulgarien, sind die Häuser der Gastarbeiter besonders groß und protzig geraten, fürchterlich kitschig, aber auch gruselig, weil sie mitten in einem der ärmsten Landstriche stehen.
Und der Großteil steht leer, denn die pensionierten Gastarbeiter kehren mehrheitlich nicht zurück. (Allenfalls bleiben sie im Sommer etwas länger als früher.) Und jene, die doch zurückkehren, wohnen in einem sehr kleinen Teil des Hauses oder, wie die Gorbatschows, in der Sommerküche daneben: Die Häuser sind zu groß, kaum instand zu halten, nicht zu heizen - praktisch unbewohnbar.
Und das waren sie von Anfang an. Ende der 1970er Jahre untersuchten Belgrader Ethnologen erstmals das damals neue Phänomen "Gastarbeiterhaus" - und staunten: Die in den Dörfern zurückgebliebenen Familienmitglieder, üblicherweise die Ältesten und die Jüngsten, bewohnten weiterhin die alten Höfe. In die großen, teuren Neubauten wollten sie nicht, die standen leer, füllten sich nur ein Mal im Jahr zum größten Familienfest, der Slava. Die Häuser, stellten die Ethnologen wenig überraschend fest, waren reine Statussymbole.
Doch hinter dieser Geldvernichtung, die so eklatant unvernünftig schien, musste, dachten einige, mehr stecken: Das Haus, das stetig weiterwuchs, meinten sie, könnte auch so etwas sein wie ein idealer Ort, an dem, in unbestimmter Zukunft, wiederhergestellt sein sollte, was die Arbeitsemigration gerade im Begriff war, für immer zu zerstören: die tradtionelle Großfamilie unter einem Dach.
Das Haus als Utopie: Ein Gedanke, der vielleicht begreifbar macht, warum so viele Gastarbeiter der Ersten Generation, Sommer für Sommer und verbissener denn je, noch weiterbauten, als längst klar war, dass ihre Kinder, mittlerweile selbst im Ausland, niemals zurückkehren würden.
Pensionisten, die zurückkehren, sind in der Regel allein. Das große Haus, den einstigen Stolz, beschreiben viele heute als größten Fehler, als Klotz am Bein. Zum Familiensitz wurde es nicht. Als Alterssitz taugt es nicht. Verkaufen kann man es nicht. Und doch hören manche selbst im Ruhestand nicht auf zu bauen: aus Gewohnheit oder damit es endlich fertig wird oder einfach gegen den längst einsetzenden Zerfall.
"Stell dir vor, du putzt dir am Ersten des Monats die Schuhe und am Letzten glänzen sie immer noch: das ist Stockholm", sagt Gorbatschow, der Schwede. Stojana und er schätzen sehr das saubere Schweden, aber sie sind auch im ostserbischen Dorf wieder zufrieden, eingebettet in ihre Zuversicht wie in die weichen Daunendecken, die sie für die Besuche ihrer Enkel aus Schweden mitgebracht haben.
Natürlich wissen sie, dass die zweite Generation nicht zurückkehrt. Normalerweise. Bei ihnen wird es anders sein, sagen sie. Warum? Weil Tochter und Schwiegersohn hier bis zu ihrer Hochzeit gelebt haben, weil sie Wurzeln schlagen konnten im Dorf. Und das Haus für sie steht schon bereit. Man muss nur noch ihre Pensionierung abwarten, gut 20 Jahre, dann wird hier, wenn der liebe Gott Gesundheit schenkt, zusammengesessen wie früher. Ich darf mich als eingeladen betrachten, sagen die beiden und lachen.
Es ist Mitte August, mein zweiter Besuch bei den Gorbatschows, Gastarbeiterurlaubssaison: Vor den Häusern stehen große Autos mit österreichischen, deutschen, italienischen Kennzeichen. Auch die Schwedenfamilie ist da - fast vollständig: nur der ältere Enkel wollte erstmals nicht mehr mit. Wir sitzen beim Swimmingpool. Auch so eine Idee aus Schweden. Dort, erklärt mir Mihajlo, hat jeder einen, im Dorf Duboka nur er. Er geht nie ins Wasser, dafür lacht man ihn aus, er weiß das; es ist ihm egal, denn er hat den Pool ohnehin für die Enkel gebaut.
Die Tochter nützt meine Anwesenheit, um sich über die Zustände im Dorf zu beklagen: über den Dreck, die Trägheit der Dörfler und ihre vulgäre Sprache. Sie und ihr Mann haben Erfolg in Schweden; sie besitzen eine Reinigungsfirma und haben sich schon ein Haus gebaut: groß genug für drei Generationen, am Stadtrand von Stockholm, beste Wohnlage - ausländerfrei.
Ihre Mutter, Stojana, serviert Kaffee und Kuchen und lächelt mit ihrer gesegneten Gabe, wegzuhören, wenn es gut für sie ist.
Text: Horst Widmer