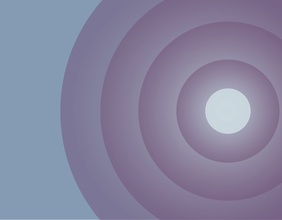Eine Geschichte von Unterdrückung und Aufbruch
Die Araber
Schon bald nach Beginn der arabischen Revolutionen, im Jahr 2011, erschienen die ersten Bücher, die den Verlauf der Ereignisse, beispielsweise auf dem Tahrir-Platz in Kairo, nachzeichneten.
8. April 2017, 21:58
Diese Werke gaben einen Einblick in die Stimmung vor Ort und vertieften die Informationen, die Interessierte in den langen Live-Berichten im Fernsehen bereits erhalten hatten. In der Regel blieben diese Bücher aber dicht am aktuellen Geschehen. Der britische Historiker Eugene Rogan, der an der Oxford Universität in Großbritannien lehrt und zu den besten Kennern der arabischen Welt zählt, liefert mit seinem neuen Buch über "Die Araber" nun den fundierten Hintergrund, vor dem die Revolutionen erst verständlich werden. Brigitte Voykowitsch hat mit Eugene Rogan gesprochen.
Niemand könne von sich behaupten, dass er die Revolutionen in der arabischen Welt im Jahr 2011 vorhergesehen habe. Auch Eugene Rogan maßt sich solch einen Weitblick nicht an. Das Besondere an Revolutionen sei ja gerade, dass sie unerwartet ausbrechen. Doch es gab klare Anzeichen dafür, dass die Unzufriedenheit wuchs - über die Ungleichheit, die Korruption und die Bemühungen arabischer Herrscher, ihre Familien durch eine dynastische Erbfolge an der Macht zu halten.
Als einen weiteren wichtigen Faktor für die Krisen, die schließlich Anlass zu Revolutionen oder zumindest Aufständen in diversen arabischen Ländern gaben, nennt Eugene Rogan den 11. September 2001. In seinem neuen Buch "Die Araber. Eine Geschichte von Unterdrückung und Aufbruch" schreibt er:
Zitat
Die Ereignisse der nachfolgenden Jahre haben Araber, wie Muslime in einer Art und Weise unter Druck gesetzt, wie nie zuvor. Des Westens sogenannter Krieg gegen den Terror, brachte in Afghanistan und im Irak ausgewachsene Kriege hervor. Innerhalb der arabischen Welt benutzten zahlreiche Regierungen den Krieg gegen den Terror als Vorwand, um scharf gegen Oppositionsbewegungen vorzugehen.
Während eine kleine Elite zum Regime stand und aus ihrer Loyalität politischen, wie finanziellen Nutzen zog, blieb einer wachsenden Zahl gut ausgebildeter junger Menschen nichts anderes übrig, als sich in die lange Schlange der Arbeitslosen einzureihen. Die wachsende Unzufriedenheit war allenthalben spürbar. Intellektuelle in Ägypten forderten die volle Beteiligung der Menschen am politischen System. Der Schriftsteller Alaa al-Aswani beendete seine Kolumnen mit dem Aufruf "Demokratie ist die Lösung".
Eugene Rogan nahm die Unruhe in der arabischen Welt zum Anlass für eine historische Betrachtung der Region. Den Ausgangspunkt seines neuen Buches bildet das Jahr 1517, als die osmanische Armee die in Ägypten herrschenden Mameluken besiegte. In den folgenden zwei Jahrhunderten dehnten die Osmanen dann ihr Reich bis in den Süden der arabischen Halbinsel und weiter über Nordafrika aus. Das heutige Syrien, Ägypten und Libyen standen unter osmanischer Oberherrschaft, das heutige Tunesien zahlte den Osmanen Tribut.
Zitat
Doch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts traten neue regionale Führer in Erscheinung, verbündeten sich und verfolgten ihre Autonomiebestrebungen. Diese Provinzgewaltigen stellten eine ernste Bedrohung des osmanischen Staates dar und sollten im 19. Jahrhundert sogar sein Überleben gefährden.
Wie hat sich im 19. und 20. Jahrhundert die moderne Landkarte des Nahen Ostens und Nordafrikas herausgebildet? 600 der mehr als 700 Seiten seines Buches widmet Eugene Rogan dieser Frage. Er analysiert die ersten Autonomiebestrebungen, schildert das Vordringen der britischen und französischen Kolonialmächte und den Zerfall des Osmanischen Reichs; er erklärt den wachsenden Antikolonialismus und schließlich den Siegeszug des arabischen Nationalismus: Erst Mitte des 20. Jahrhunderts formierten sich viele Staaten der arabischen Welt in der Form, wie wir sie heute kennen.
Eine heikle Frage seit dem 19. Jahrhundert war, die nach der Rolle des Islam in der modernen Welt. Es gab islamistische Reformer, islamistische Modernisten, die darüber diskutierten, wie man in der modernen Welt islamische Werte erhalten könnte. Der einflussreiche Gelehrte Dschamal ad-Din al-Afghani reiste kreuz und quer durch das Osmanische Reich. An der berühmten Al Azhar-Moschee und Universität in Kairo sammelte er dann einen Gelehrtenkreis um sich. Diesem Kreis gehörten Leute wie Mohammed Abduh an, die die Vision eines Islam verfolgten, der mit der modernen Welt absolut vereinbar war. Gemäß diesen Vorstellungen sollten Araber und Muslime sich öffnen für die Entwicklungen, die aus der europäischen Aufklärung und der industriellen Revolution hervorgegangen waren.
Ein wiedererstarkter Islam
Der Macht des Islam widmet Eugene Rogan ebenso ein eigenes Kapitel, wie der Bedeutung des Erdöls für die arabische Welt. Gerade in Anbetracht der prominenten Stellung, die der Islam heute im öffentlichen Leben der arabischen Welt einnimmt, erinnert der Historiker daran, wie säkular der Nahe Osten noch bis Ende der 1970er Jahre war.
Bemerkenswert ist, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts der Islam im politischen Diskurs nur mehr eine marginale Rolle spielte. Der Islam war wirklich nur mehr ein gemeinsames kulturelles Element, das alle Araber teilten. Auch die Christen und Juden konnten den kulturellen Islam, als Teil ihrer arabischen Identität ansehen. Abgesehen von Randgruppen wie den Muslimbrüdern dachte niemand daran, den Islam zur Grundlage einer politischen Partei zu machen. Bis weit in die 1970er Jahre hinein dominierte in der Politik der Säkularismus.
Internationale Entwicklungen, wie die iranische Revolution 1979 und der Einmarsch der Sowjets in Afghanistan im selben Jahr, aber auch der anhaltenden Nahost-Konflikt mit Israel, gaben in der Folge islamistischen Strömungen Aufwind. In Ägypten verlieh Präsident Anwar al-Sadat aus innenpolitischen Gründen dem Islam mehr Gewicht.
Die ägyptische Regierung musste dringend Arbeitsplätze schaffen und Investitionen anlocken. Für die Öffnung der Wirtschaft benötigte die Regierung aber die Unterstützung breiterer Bevölkerungsschichten. Präsident Sadat bemühte sich insbesondere, islamische Akteure für sich zu gewinnen. Von da an kehrte er seine Frömmigkeit hervor, und schließlich hatte auch er den braunen Fleck auf der Stirn, den fromme Muslime bekommen, wenn sie fünf Mal am Tag ihre Gebete verrichten. Die Förderung des Glaubens und islamischer Werte kehrte sich schließlich gegen Sadat, der wegen seiner Unterzeichnung des Friedensvertrags mit Israel 1981 von radikalen Islamisten ermordet wurde.
Nicht zur Debatten stand hingegen Demokratie. Die autokratischen arabischen Regime ließen wenig Raum für freie intellektuelle und politische Debatten. Seit den 1950er gingen daher zahlreiche arabische Intellektuelle in den Westen.
Zitat
Wenn die arabischen Völker in den Genuss von Menschenrechten und einer verantwortlichen Regierung kommen wollen, wenn sie Sicherheit und wirtschaftliches Wachstum erlangen wollen, werden sie selbst die Initiative ergreifen müssen.
Mit dieser Feststellung beendete Eugene Rogan die englische Ausgabe seines monumentalen Werkes über "Die Araber", die 2009 erschien. Das Buch liefert die historische Grundlage, um die aktuellen Ereignisse einordnen zu können. Eugen Rogan konnte nicht wissen, dass wenig mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Buches, der tunesische Gemüsehändler Mohammed Bouazizi mit seiner Selbstverbrennung den Funken der Revolution zünden würde. Die Geschehnisse des Jahres 2011 – die Revolutionen in Tunesien, Ägypten und Libyen sowie die Aufstände im Jemen, in Bahrain und in Syrien - fasst Eugene Rogan nun in einem ausführlichen Vorwort zusammen, das er eigens für die deutsche Ausgabe geschrieben hat.
Service
Eugene Rogan,"Die Araber. Eine Geschichte von Unterdrückung und Aufbruch", aus dem Englischen übersetzt von Hans Freundl, Norbert Juraschitz, Oliver Grasmück, Propyläen-Verlag 2012