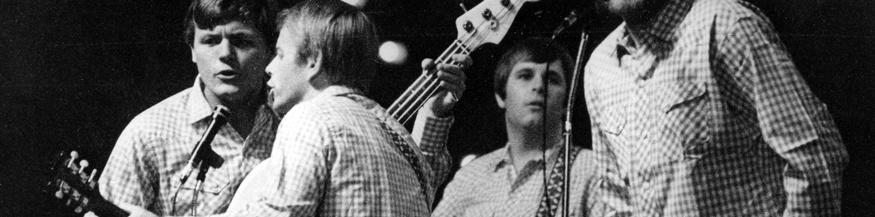Israelische Soldaten berichten
Das Schweigen brechen
"Breaking the Silence" ("Das Schweigen brechen") heißt eine Vereinigung von ehemaligen aktiven Soldaten und Soldatinnen der israelischen Armee. Sie haben jetzt ein Buch mit demselben Titel herausgebracht. Darin berichten ehemalige Soldaten und Soldatinnen von ihrem Einsatz in den besetzten Gebieten.
8. April 2017, 21:58
Die Landsleute konfrontieren
"In Israel das Schweigen über diese Dinge zu brechen, ist genauso, als würde man seinen Eltern sagen, dass man homosexuell ist. Wir wollen den Leuten zeigen, dass es besser ist, darüber zu reden, statt es unter den Teppich zu kehren", ist Dana Golan überzeugt. Sie und die anderen Reservisten der israelischen Nichtregierungsorganisation "Breaking the Silence” haben begonnen, dieses Schweigen zu brechen. Sie interviewen Männer und Frauen, die in Gaza, dem Westjordanland und Ostjerusalem stationiert waren, und verbreiten ihre Berichte auf einer Internetseite, in Broschüren und über die Medien. Zudem halten sie Vorträge und zeigen Filme. So wollen sie ihre Landsleute mit der Besatzungsrealität konfrontieren, von der sie selbst einmal ein Teil waren. Seit Gründung ihrer Organisation 2004 haben sie mehr als 700 Soldaten und Soldatinnen aller Dienstgrade und aus allen Schichten der israelischen Gesellschaft interviewt. 146 dieser Berichte haben sie für ihr Buch ausgewählt.
"Das Besondere an diesem Buch ist, dass es auch Analysen beinhaltet", erklärt Dana Golan. Denn bisher hat die NGO Augenzeugenberichte stets unkommentiert veröffentlicht: "Inzwischen haben wir aber genug Informationen, um ein umfassenderes Bild geben zu können von dem, was wirklich vor sich geht und was es für die Menschen vor Ort bedeutet, was Politiker hinter verschlossenen Türen beschließen."
Die alltäglichen Schikanen
Im Buch berichten die Augenzeugen unter anderem von der stillschweigenden Zusammenarbeit der Armee mit extremistischen jüdischen Siedlern. Sie erzählen auch von den alltäglichen Schikanen, denen Menschen in den besetzten Gebieten ausgesetzt sind. Ihre Erlebnisse während dieser Zeit haben ihre Sichtweise auf die Besatzungspolitik verändert. Ihrer Ansicht nach sollen alle Israelis wissen, was in ihrem Namen dort geschieht. Deshalb auch das Buch. Die hebräische Originalausgabe erschien 2010, zehn Jahre nach Beginn der Zweiten Intifada.
Unterm Strich wolle man auch verstehen, was sich in diesen letzten zehn Jahren verändert hat, sagt Dana Golan: "Alles, was passiert und was die Armee in Israel und den besetzten Gebieten tut, wird mit der Brille des Sicherheitsarguments betrachtet. Leider mussten wir feststellen, dass das ein Trugschluss ist. Wir haben uns im Buch vier Schlagwörter für militärische Einsätze vorgenommen, die wir oft in den Nachrichten hören und die für die meisten Israelis mit einer positiven Assoziation verbunden sind. Und wir erklären, was tatsächlich hinter diesen Codewörtern steckt."
Den palästinensischen Alltag stören
Im Buch geht es wesentlich um vier offizielle Begriffe: die "Vorbeugung" feindlicher terroristischer Aktivitäten, die "Trennung" von Israel und der palästinensischen Bevölkerung, die Bewahrung der palästinensischen "Lebensstruktur" und die "Durchsetzung von Recht und Ordnung". Die einzelnen Kapitel des Buches erläutern zunächst eines dieser Schlagwörter und stellen dem anschließend die Berichte der Soldaten gegenüber. Sichtbar werden nicht nur die Einsatzprinzipien der Armee, sondern auch die Politik der Behörden sowie deren Folgen - auf Palästinenser, jüdische Siedler und die Soldaten selbst.
Unter das Schlagwort "Vorbeugung" fällt etwa auch der Befehl "Präsenz zu zeigen". Dana Golan beschreibt, wie das in der Praxis aussieht: "Die Soldaten gehen dann zum Beispiel in ein Dorf und stören den Alltag der Palästinenser, indem sie auf Wassererhitzer schießen oder auf Fenster oder auf Mistkübel. Oder sie legen Feuer oder machen viel Lärm. ”Vorbeugung” bedeutet dabei nichts anderes, als alle Palästinenser als mögliche Terroristen zu behandeln. Wir Soldaten müssen diese Missionen durchführen. Wenn dann der Feind plötzlich ein vierjähriges Kind oder eine 60jährige Frau ist, wird das für uns sehr problematisch."
18-jährige verfügen über Leben und Tod
Dana Golan weiß, wovon sie spricht. 2001 wurde sie zum Wehrdienst eingezogen und wenig später auf einem Militärstützpunkt in Hebron stationiert. Sie war 18 Jahre alt und ein bisschen stolz. Denn im Westjordanland diente sie, so hatte sie es gelernt, um ihr Land und ihre Familie gegen Terroristen zu verteidigen. "Dann kommst du in einen Ort wie Hebron - und plötzlich verstehst du. Wenn du siehst, wie schlecht die Palästinenser dort leben, begreifst du, dass die Besatzung den Konflikt nur festigt. Ich als Israeli werde immer stärker sein, und mein Leben wird immer mehr wert sein als das eines Palästinensers. Das hat mich sehr erschüttert."
Das Problem seien nicht die Soldaten selbst, versichert Golan: "Die Regierung stellt diese jungen Leute an die Checkpoints, sie gibt ihnen Waffen und die Verfügungsgewalt über das Leben anderer Menschen! Das Ergebnis kann nur schrecklich sein."
Gilad Shalit, der junge Soldat, der 2011 von der Hamas nach fünf Jahren freigelassen wurde, ist für Dana Golan ein Paradebeispiel für diese Politik: Er wurde nicht nur ihr Opfer, sondern auch gegen mehr als 1.000 Palästinenser ausgetauscht. Die Reservisten von "Breaking the Silence" sind zwar froh, dass er wieder zu Hause ist. Sie kritisieren jedoch das Mantra der israelischen Regierung, die ganze Besatzung geschehe aus rein defensiver Taktik, sagt Dana Golan: "Die Regierung wiederholt immer wieder, wir hätten keine andere Wahl. Damit rechtfertigen inzwischen auch andere Israelis alles. Sie meinen, die Übergriffe bei der Besatzung seien Einzelfälle - die berühmten faulen Äpfel".
Frauen mit schmutzigen Händen
Sie ist überzeugt: Würde man die Soldaten besser ausbilden, wären sie an den Checkpoints vielleicht netter. Doch im Grunde gehe is nicht nur um die Soldaten an den Checkpoints, sondern um die Tatsache, dass es überhaupt Checkpoints gibt. Denn, so Dana Golan: eine "nette" Besatzung sei unmöglich.
Die meisten Israelis haben die Besatzung jedoch nie mit eigenen Augen erlebt. Zwar müssen alle - Frauen wie Männer - mit 18 zum Militär, aber nur zehn Prozent von ihnen dienen in den besetzten Gebieten. Dana Golan erzählt bei Vorträgen deshalb immer wieder, was sie dort erlebt hat, wie sie die ersten Zweifel fühlte - und wie lange es dauerte, lange nach dem Ende ihrer Wehrzeit, bis sie zu ihnen stehen konnte.
Im Dokumentarfilm "To see if I'm smiling" ("Um zu sehen, ob ich lächle") von der israelischen Filmemacherin Tamar Yarom, erzählten sechs junge Soldatinnen, darunter Dana Golan, über ihre Erlebnisse in den besetzten Gebieten. Knapp zehn Prozent der Soldaten dort sind Frauen. In ihrem Verhalten, sagt Dana Golan, unterschieden sie sich kaum von den Männern. Dies sei ebenfalls eine Erkenntnis, die die israelische Bevölkerung nur schwer wahrhaben wolle: Wenn ich den Film in Israel zeige, reagieren die Leute jedes Mal völlig angewidert. Nicht so sehr über das, was die Frauen berichten, sondern weil es Frauen sind, die diese Geschichten erzählen", berichtet Golan, "die Leute wollen einfach nicht glauben, dass Frauen sich die Hände genauso schmutzig machen. Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich Frauen gezwungen hatte, sich nackt auszuziehen, um sie nach Waffen zu durchsuchen, war sie auch angewidert."
Als Verräter beschimpft
Der Film inspirierte die Vereinigung "Breaking the Silence" dazu, über die Erfahrungen von männlichen Soldaten einen eigenen Film zu produzieren. 60 Reservisten und Reservistinnen gründeten die Organisation vor acht Jahren, inzwischen sind sie mehr als 800. Sie verstehen sich nicht als politische Bewegung, sondern als Experten in Sachen gelebte Besatzung. Die im Buch versammelten Augenzeugenberichte vermitteln einen breiten und überaus lebendigen und aufrüttelnden Einblick in die Besatzungsrealität.
Politiker und Diplomaten würden immer so tun, als wäre der Friedensprozess gerade um die nächste Ecke, kritisiert Golan: "Aber während diese Leute in schönen klimatisierten Räumen darüber reden, erleben die Soldaten vor Ort die Situation völlig anders. Ihren Erfahrungen nach kann von einer anderen Zukunft keine Rede sein. Wie auch unser damaliger Außenminister Lieberman bei den Vereinten Nationen gesagt hat: Die Besatzung soll bleiben." Dana Golan und die anderen Veteranen von "Breaking the Silence" wollen dies verhindern. Eines Tages, hofft Dana Golan, werden sie auch jene Israelis überzeugen können, die sie heute noch als Verräterin beschimpfen.
Service
"Breaking the Silence": Israelische Soldaten berichten von ihrem Einsatz in den besetzten Gebieten, Econ Verlag
Breaking the Silence